LabourNet Germany | ||||
| Home | Über uns | Suchen | Termine | |
Anmerkungen zum Konzept der Neuen Arbeitsorganisation
Stefan Meins
Ein Aufsatz, der Spätsommer 2001 im Workshop zum Thema "Arbeitssucht in der Arbeitsgesellschaft" des SEARI Institut (Uni Bremen) präsentiert wurde.
Stellt man die Frage nach den Formen und der Bedeutung von Sucht, so muss in allen Überlegungen dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die moderne Gesellschaft zentral als Arbeitsgesellschaft konstituiert ist. Arbeit ist für die meisten Menschen Quelle von Einkommen und definiert die Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Reichtum zu partizipieren. Über Arbeit konstituieren sich soziale Beziehungen, Arbeit bestimmt immer noch wesentlich den Stellenwert, den wir im sozialen Gefüge der Gesellschaft einnehmen. Wenn Arbeit ein so zentrales Moment im Leben der meisten Menschen bildet, dann müssen die Formen, in denen wir arbeiten und die sozialen Beziehungen, in die wir durch Arbeit gestellt sind, gerade bei einer Betrachtung der Suchtform, die Arbeit zu ihrem Inhalt hat, der Arbeitssucht, im Mittelpunkt des Interesses stehen. Diese Feststellung gewinnt noch an Bedeutung, wenn man das Augenmerk auf aktuelle Veränderungen in der Arbeitswelt richtet. Von gewerkschaftlicher Seite werden neue Konzepte zur "Aktivierung" der Beschäftigten und zur Re-Organisation innerbetrieblicher Beziehungen als Momente einer veränderten Einstellung zur Arbeit beschrieben. Die zunehmende Zentrierung des Lebens um die Arbeit trägt, aus dieser Perspektive betrachtet, viele krankmachende und Suchtprozesse fördernde Elemente in sich (Glismann 2000, Peters 1997). Die neue Freiheit in der Arbeit gerät - so die These - schnell zu einer potenziellen Basis für Arbeitssucht.
Um die Bedeutung neuer betrieblicher Organisationsformen für das Verhältnis der Beschäftigten zu ihrer Arbeit zu diskutieren, sollen nachfolgend drei Überlegungen angestellt werden. In einem ersten Schritt soll die aktuelle Entwicklung der Arbeitsbeziehungen stichpunktartig nachgezeichnet werden. Als Referenz dient hier die tayloristische Organisation von Arbeit, um das Neue der aktuellen Entwicklung besser charakterisieren zu können. Danach soll kurz der Frage nachgegangen werden, welche Bereiche der deutschen Wirtschaft und welche Beschäftigtengruppen von den geschilderten Umstrukturierungen besonders betroffen sind. Ist so der Rahmen abgesteckt, in dem sich die Entwicklung vollzieht, können mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigten thematisiert werden. In der Literatur finden sich hier zwei völlig gegensätzliche Einschätzungen. Sprechen die einen von einem Gewinn von Freiheit, von einem Zuwachs an Selbstbestimmung, der eine Verwirklichung in der Arbeit und den Abbau hierarchisch-autoritärer Zwangssysteme verspricht, stellen die neuen Arbeitsformen für andere eine bloße Ersetzung äußerer Zwänge durch innere Kontrollmechanismen dar. Die Beschäftigten sind hier scheinbar einem Diktat von Selbstzwängen unterworfen, das ihnen zwar äußere Freiheiten beschert, jedoch letztlich in einer Instrumentalisierung ihrer Wünsche und Bedürfnisse für unternehmerische Zwecke mündet. Zentrale Bedeutung erlangt in dieser Diskussion der Begriff der Autonomie. Können die Beschäftigten die neu gewonnene äußere Autonomie ihren Interessen entsprechen nutzen? Besitzen sie soviel innere Autonomie, um den Zwängen, denen sie zweifellos weiter unterworfen bleiben, eigene Zwecke entgegenzusetzen? Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es zu allererst einer begrifflichen Klärung, die zum Abschluss zumindest ansatzweise geleistet werden soll.
Tayloristische und post-tayloristische Formen von Arbeit
Aus ökonomischer Perspektive bildet der Arbeitsvertrag das zentrale Moment der Organisation von Arbeit. Hier verpflichtet sich der Arbeitnehmer, dem Unternehmer die Nutzung seiner Arbeitskraft zu bestimmten Bedingungen zu überlassen. Der Unternehmer eignet sich so die Potenz des Arbeitnehmers an, durch Arbeit Werte zu erzeugen. Die Nutzungsmöglichkeit der Arbeitskraft beinhaltet jedoch keine unumschränkte Verfügungsgewalt über die Person des Arbeitnehmers. Arbeitskraft ist als Ware nicht von seinem Besitzer zu trennen. Da der Unternehmer so nicht allein über deren Verwendung entscheiden kann, sondern immer auf die Mitwirkung des Arbeitnehmers angewiesen ist, muss er Mittel und Wege ersinnen, ihn zur vertragsgemäßen Arbeitsleistung zu bewegen, denn eine Garantie, dass die vertraglichen Vereinbarungen auch erfüllt werden, besteht für keine Vertragspartei (Williamson 1990, 23f).
Allgemein ergeben sich zwei entgegengesetzte Lösungsstrategien. Die Vertragserfüllung kann durch permanente Kontrolle und entsprechende Zwangsmaßnahmen gesichert werden. Die Kosten dieser Strategie steigen jedoch mit zunehmender Komplexität der zu überwachenden Tätigkeiten und Produktionsnetzwerke überproportional an (North 1992, 49). Sinnvoller wäre ein zweiter Lösungsweg, bei dem die Arbeitnehmer selbst schon das Engagement mitbringen, das zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob dieses Engagement als natürliche menschliche Eigenschaft einfach vorausgesetzt werden kann oder ob es hier einiger Motivationshilfe in Form von materiellen und nicht-materiellen Anreizen bedarf, um die Einhaltung des Vertrages zu garantieren[1]. Die Antwort der ökonomischen Theorie auf diese Problemstellung ist klar und eindeutig: Arbeit wird gleichgesetzt mit Mühsal, verursacht einen negativen Nutzen, ist Leid, dass man nur zu ertragen bereit ist, wenn entsprechende Gratifikationen dabei herausspringen. Wäre Arbeit durch Spaß und Selbsterfüllung geprägt, gäbe es kein Anreizproblem und somit keine Notwendigkeit, Arbeitsleistung durch Belohnung oder Zwang zu fördern[2]. Da man real aber immer mit einem natürlichen Widerstand gegen die Arbeit rechnen müsse, seien beide Wege zur Sicherung der Vertragserfüllung zu beschreiten, denn nur so könne der Faktor Arbeit einen für alle nutzbringenden Beitrag im Wirtschaftsgeschehen erbringen.
Der Grundüberzeugung, dass der Mensch von einer natürlichen Abneigung gegen die Arbeit bestimmt sei, folgte auch F. W. Taylor, der von der Motivation der Arbeiter, die vertraglich vereinbarte Arbeitsleitung auch zu erbringen, nicht gerade überzeugt war. "Die Menschen sind von Natur aus ziemlich faul, aber der größere Schaden für Arbeiter und Unternehmer entsteht aus jener systematischen Langsamkeit, der man in allen organisatorischen Systemen begegnen kann. Sie stellt die Art und Weise dar, in der die Arbeiter ihre eigenen Interessen verfolgen" (Taylor 1912). Im kapitalistischen Unternehmen prallen für ihn zwei grundsätzlich verschiedene Einstellungen aufeinander. Hier das Interesse der Unternehmer an maximaler Arbeitsleistung, dort der Widerwillen der Arbeiter und ihr Bemühen, jeder Anstrengung möglichst aus dem Wege zu gehen und die wirklichen Potenzen ihrer Arbeitskraft zu verbergen. Die Lösung, die Taylor für diesen Widerspruch präsentierte, beruht auf der expliziten Anerkennung dieser Andersartigkeit des produktiven Faktors. Die von ihm aufgestellten Prinzipien wissenschaftlicher Betriebsführung fußen auf der Überzeugung, dass Arbeitsleistung den Beschäftigten durch organisatorische Maßnahmen abgerungen werden müsste, dass die bewusst zurückgehaltenen Potenziale der Arbeitskraft ans Licht unternehmerischer Dispositionen gebracht werden müssten, um die Arbeitskraft maximal nutzen zu können. Im Kern handelt es sich um den Versuch, den Arbeitnehmern die Kontrolle über ihr Arbeitsvermögen zu entreißen. Durch Erfassung, Bewertung und wissenschaftlich angeleitete Neukombination der Tätigkeiten sollten diese möglichst vollständig von ihren Trägern abgetrennt und so von jedem Bezug auf die Subjektivität der Beschäftigten gereinigt werden. Innerhalb der polarisierten Sichtweise Taylors sollte der Einfluss zurückgedrängt werden, den die Arbeitnehmer auf Grund des nur ihnen zugänglichen Wissens um ihre Arbeitsfähigkeit auf den Produktionsprozess ausübten.
Der Unternehmer fungierte in diesem Konzept als Mittler zwischen einer chaotischen Außenwelt, in der anonyme "Marktkräfte" mögliche Absatzchancen und Gewinnerwartungen bestimmen und einer vorausschauend planbaren Innenwelt des Betriebes, in der die einzelnen Tätigkeiten und Verweisungszusammenhänge nach rationalen Kriterien kombiniert werden. Aufgabe der Betriebsleitung war es somit, möglichst alle relevanten Informationen zu sammeln und so in einen Produktionsplan zu integrieren, dass letztlich ein gut verkäufliches und Gewinn versprechendes Produkt entstand. Um den erwarteten Gewinn zu realisieren, musste der Plan nur konsequent umgesetzt werden, durfte nicht durch Eigeninitiative verändert oder umgangen werden. Da der Plan nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt worden war, konnte ein Eingriff in die festgelegten Abläufe nur irrational sein, musste den Prinzipien wissenschaftlicher Betriebsführung zuwiderlaufen.
Damit galt es, jede Abweichung von der Norm zu bekämpfen. Neben die Abspaltung des Arbeitsvermögens von seinem Besitzer tritt so unvermeidlich die Kontrolle. Mit ihrer streng hierarchischen Organisationsform ist die fordistische Fabrik auf das Prinzip der Überwachung gegründet. Überwacht werden muss die Planerfüllung jeder Abteilung und ganz allgemein die Tätigkeit jedes einzelnen, denn ein Interesse an der Arbeit, das die Kontrolle der Beschäftigten weniger aufwendig machen würde, wird durch das zugrunde liegende Menschenbild von vornherein aus den Überlegungen ausgeschlossen. In der fordistischen Fabrik wird die "natürliche" Abneigung gegen die Arbeit und der rein äußerliche, auf reine Nützlichkeitsüberlegungen gegründete Umgang mit jeder Form von entlohnter Tätigkeit, der kennzeichnend für das ökonomische Modell ist, als betriebliche Organisationsform so auch real wahr. In dieser Produktionsweise "... wird das ‚Anderssein‘ des produktiven Subjekts als gegeben vorausgesetzt. Sein natürlicher Widerstand gegen das Erbringen von Arbeit wird das eigentliche – man könnte sagen ‚anthropologische‘ – Fundament des Organisationsmodells" (Revelli 1997, 7).
Innerhalb einer auf Hierarchie und Kontrolle gegründeten Organisation entstehen jedoch notwendig Reibungsverluste. Trotz ausgefeilter Methodik gelingt es vielfach nicht, alle relevanten Informationen an die zuständigen Stellen zu leiten. Planvorgaben werden nicht konsequent genug umgesetzt, bei der praktischen Realisierung theoretisch konzipierter Verfahren tauchen unvorhersehbare Probleme auf. Genau an diesen Stellen versagt ein Organisationsmodell, dass zentral auf die mechanische Ausführung absolut gesetzter Planvorgaben gerichtet ist. Daher müssen die zu erwartenden Disfunktionalitäten durch geeignete Maßnahmen abgefedert werden. Dies geschieht zum einen durch eine extensive Lagerhaltung, die an Schwachstellen des Produktionsflusses Pufferfunktionen erfüllt. Zum anderen kann auf die Initiative der Beschäftigten entgegen den tayloristischen Grundprinzipien doch nicht gänzlich verzichtet werden. Immer dort, wo der Plan versagt, ist ihr Engagement gefragt, müssen die von ihnen abseits des hierarchisch strukturierten Informationsflusses geschaffenen informellen Netzwerke genutzt werden, um Fehlfunktionen zu beheben oder zumindest zu kaschieren. Auch der fordistische Betrieb bleibt so angewiesen auf seine Mitarbeiter.
Trotz dieser nicht zu ignorierenden Relevanz des "subjektiven Faktors", bleibt die rationale, objektive Planung und Durchführung betrieblicher Prozesse jedoch bestimmende Leitlinie tayloristischer Arbeitsorganisation. Das herausragende organisatorische Prinzip mit dem den Kosten innerbetrieblicher Reibungsverluste begegnet werden sollte, war dann auch eher ein technisches. Durch die konsequente Nutzung von Skalenerträgen konnte bei relativ unbegrenzten Absatzmärkten jedes strategische Kostenproblem durch die Steigerung der Produktionsmenge beseitigt werden. Bei einem gegen Unendlich strebenden Produktionsvolumen werden Kosten der Organisation und betrieblicher Ineffizienzen zu einem vernachlässigungswürdigen Faktor. Die fordistische Fabrik konnte so einen relativ hohen Grand an organisatorischer "Porösität" aufweisen. Bis zu 30% der Beschäftigten war hier mit Aufgaben außerhalb des eigentlichen Wertschöpfungsprozesses befasst (Revelli 1997, 5). Als Prüfer, Lagerarbeiter oder Kontrolleur hatten sie die Schwachstellen der betrieblichen Organisation auszufüllen und einen stabilen Produktionsfluss sicherzustellen. Angesichts hoher Stückzahlen von weitgehend standardisierten Produkten fielen diese zusätzlichen Kosten aber nicht sonderlich ins Gewicht. Sollten trotzdem Probleme bei der Gewinnrealisierung entstehen, brauchte man prinzipiell nur für eine Ausweitung des Produktionsausstoßes zu sorgen, um Probleme zum Verschwinden zu bringen.
Die im Taylorismus vorherrschende polarisierte Sicht auf die betrieblichen Arbeitsbeziehungen wurde auch von den Beschäftigten erwidert. Sie erlebten vielfach eine sinnentleerte Arbeitswelt, in der sie als Person, als mit besonderen Fähigkeiten, Wünschen und Bedürfnissen ausgestattete Individuen nicht vorkamen. Einzig die Erfüllung vorgegebener, auf wenige Arbeitsschritte beschränkter Planvorgaben wurde hier von ihnen verlangt. Gleichzeitig führten die allenthalben beobachtbaren Reibungsverluste innerhalb der bürokratisierten Anweisungsketten zur Demotivation, zu einem fehlenden Interesse, sich über den zugewiesenen Arbeitsbereich hinaus im Betrieb zu engagieren. Arbeit erhält hier einen rein instrumentellen Charakter, dient fast ausschließlich dem Gelderwerb. Damit kam es zu einem Gleichklang der Interessen von Arbeit und Kapital. Das einzige, was von Unternehmensseite verlangt wurde, war die von Individualität gereinigte Nutzungsmöglichkeit der Arbeitskraft und dieser Umstand kam den Interessen der Arbeitnehmer entgegen, die eigene Person möglichst aus dem betrieblichen Geschehen herauszuhalten, eigene Interessen und Bedürfnisse auf den privaten Bereich, auf die Freizeit auszurichten. Allgemein lässt sich für die fordistische Periode dann auch eine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit feststellen. In der Arbeit hatte man zu funktionieren, hatte seine persönlichen Wünsche und Befindlichkeiten zurückzustellen, um gleichsam als subjektloses Arbeitsvermögen entsprechend den vom Betrieb gesetzten Vorgaben zu agieren. In der arbeitsfreien Zeit galt es, als Konsument und Bürger persönliche Interessen zu verfolgen, durch Freizeitaktivitäten und Konsum das Leid der Arbeit möglichst zu kompensieren. Diese instrumentelle Beziehung zur Arbeit wurde dann auch zum Ausgangspunkt gewerkschaftlicher Interessenvertretung. Es galt einerseits die Arbeitskraft vor jedem über die vertraglichen Vereinbarungen hinausgehenden Übergriff der Unternehmensleitung zu schützen. Dies betraf sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Arbeitszeit. Hier wurde das von Unternehmensseite geschaffene Überwachungsinstrument, die Stechuhr, zu einem Element des gewerkschaftlichen Kampfes um die Einhaltung der vereinbarten Arbeitszeiten. Wenn die Arbeit einen derart sinnentleerten Charakter aufwies, sollte auch jede Minute adäquat entlohnt werden, um den Beschäftigten so einen gewissen Ausgleich für ertragenes Arbeitsleid zu bieten. Andererseits war es Ziel der Gewerkschaften, die Arbeitnehmer am wachsenden Wohlstand angemessen zu beteiligen. Auf das Produktivitätswachstum bezogene Lohnsteigerungen standen ebenso auf den gewerkschaftlichen Forderungskatalogen wie die Verkürzung der Arbeitszeit.
Konnten mit dem Modell einer autoritär-hierarchischen Betriebsführung bis in die frühen siebziger Jahre hinein beträchtliche Rationalisierungspotenziale erschlossen und so relativ hohe Profitraten realisiert werden und konnte gleichzeitig durch gewerkschaftliche Kämpfe um Lohnsteigerungen ein Konsumniveau erreicht werden, das den Arbeitnehmern zumindest einen gewissen Ausgleich für die Monotonie und die Belastungen der tayloristischen Arbeitsverhältnisse bot, so gerät dieses Organisationsmodell in den Folgejahren von zwei Seiten unter Druck. Von den Arbeitnehmern wurden verstärkt Forderungen geäußert, der Zerstückelung der Tätigkeiten, einseitiger Belastung und der allseits anzutreffenden Monotonie der Arbeit durch Anreicherung des Tätigkeitsspektrums, durch Teamarbeit und durch die Übertragung von mehr Verantwortung für den eigenen Arbeitsbereich entgegenzutreten. Diese Diskussion über die Humanisierung der Arbeit resultierte in gewerkschaftlichen Programmen, die unter den Stichworten job enlargement, job enrichment und job rotation bekannt wurden. Daneben bildete die Verkürzung der Arbeitszeit eine wichtige Forderung. Im Zuge der hergebrachten Logik einer Trennung von Arbeit und Freizeit galt es hier, den Anteil der Freizeit gegenüber der Arbeitszeit möglichst auszudehnen, um den Beschäftigten mehr Chancen zu Selbstverwirklichung und Regeneration zu eröffnen.
Auf Seiten der Unternehmen war die einsetzende Diskussion über Umstrukturierungsmaßnahmen weitweniger einem Humanisierungsgedanken verpflichtet. Vielmehr wurden entsprechende organisatorische Umstellungen von einer veränderten Marktlage und durch die Erschöpfung tayloristischer Rationalisierungspotentiale erzwungen. In einer Welt, in der die scheinbar unbegrenzten Absatzmöglichkeiten der fordistischen Ära nicht mehr gegeben waren, konnte das Instrument der Skalenvorteile die Schwachstellen tayloristischer Organisationsmethoden nicht mehr verdecken. Die Umstellung der Produktion auf kleinere Losgrößen und eine raschere Modellfolge machten Kosten der Kontrolle und Überwachung sowie die ausgedehnte Lagerhaltung der fordistischen Fabrik zu einem entscheidenden Nachteil im internationalen Wettbewerb. Das Augenmerk der Unternehmensleitungen richtete sich so zuerst auf die Vermeidung von Reibungsverlusten. In Zeiten verlangsamten Wachstums sollte eine umfassende Reorganisation für eine Kostenreduktion sorgen, die selbst bei stagnierender Absatzmenge zusätzliche Profite erwarten ließ. Die Antwort auf den Niedergang des fordistischen Modells war das Aufspüren und Beseitigen möglichst aller ‚porösen‘ und damit unproduktiven Elemente innerhalb der betrieblichen Organisation.
Das erfolgreiche japanische Modell der toyotistischen Fabrik ist dann auch gekennzeichnet durch die Einsparung von Lagerbeständen und die Reorganisation der Produktionsabläufe im Hinblick auf Bestandsverringerungen, durch total quality management und die Verschlankung der betrieblichen Hierarchie. Eine grundlegende Veränderung bildet hier die Umkehr des betrieblichen Informationsflusses und der Planungsperspektive. Wurden in der fordistischen Fabrik alle Produktionsgänge vom Rohmaterial zum fertigen Produkt in linearer zeitlicher Aufeinanderfolge planerisch erfasst und umgesetzt, so wurde nun das Endprodukt zum Ausgangspunkt der Betrachtung. Die Informationen fließen im Kan-Ban System vom Abnehmer zur vorgeordneten Stelle, die dann nur die jeweils erforderlichen Teile produzieren muss. Eine zwischenzeitliche Lagerung entfällt weitgehend. War im fordistischen Betrieb der Preis als Summe der zuvor angefallenen Kosten bestimmt worden, so sollen sich die Kosten jetzt dem Preis unterordnen. Gefragt wird, welche Merkmale ein Produkt besitzen muss, um marktgängig zu sein und welche Kosten bei der Produktion entstehen. Mit dem Begriff des target costing wird eine veränderte Kalkulationsweise bei der Bestimmung der Absatzpreise beschrieben, die den realisierbaren Marktpreis zur Grundlage aller weiteren Planungen macht (Monden 1999).
Hier greift eine radikale Veränderung der Beziehungen zwischen Markt und Unternehmen. War es das Ziel fordistischer Organisationskonzepte, wenn möglich den Markt an die Rhythmen einer geplanten Produktion anzupassen, so kehrt sich in der post-fordistischen Ära diese Sichtweise um. Nun ist es Aufgabe der Produktion auf die Unwägbarkeiten des Marktes zu reagieren, wechselnde Kundenwünsche mit flexiblen Anpassungsstrategien zu befriedigen. Und diese Anpassungsleistungen können nur vollzogen werden, wenn sowohl die Organisation als auch die einzelnen Organisationsmitglieder genügend Freiraum besitzen, um geeignete Strategien zu entwickeln. Innerhalb der Diskussion um alternative betriebliche Organisationsformen spielen folglich Konzepte der Flexibilisierung und Dezentralisierung eine herausragende Rolle. Die Reaktionsfähigkeit und die Kundennähe der Betriebe soll durch die Übertragung von Verantwortung an die jeweils zuständigen Abteilungen gefördert werden. Durch eine direkte Konfrontation mit den Erfordernissen des Marktes sollen Abteilungen eher in die Lage versetzt werden, "unbürokratisch" zu reagieren und abseits von zentralen Planungen zeitnahe Lösungen für entstehende Probleme zu finden. Gleichzeitig dient der Aufbau teilautonomer Abteilungen und Betriebszweige dem Abbau betrieblicher Hierarchieebenen und soll letztlich zu einer beträchtlichen Kostenreduktion führen. Indem auch innerhalb der Unternehmung marktähnliche Lieferbeziehungen konstituiert werden, unterliegen die Abteilungen viel eher als in der fordistischen Ära dem Druck, ihre Profitabilität durch Leistung nachzuweisen. In diesen vermarktlichten Beziehungen soll jede Entscheidung unter dem Aspekt bewertet werden, ob eine vergleichbare Leistung nicht auch kostengünstiger von außerhalb bezogen werden könnte. Der Bestand der Abteilung wird so nicht nur an den Fortbestand des Betriebes geknüpft, sondern auch an die jeweilige Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft im Vergleich mit anderen am Markt tätigen Unternehmen.
Diese Veränderungen implizieren notwendig eine Aktivierung der Beschäftigten. Der einzelne soll wieder Verantwortung übernehmen, soll, entgegen den tayloristischen Prinzipien, als Subjekt in den Produktionsprozess eingreifen. Beispielhaft lässt sich diese veränderte Sichtweise anhand eines von Lehmann präsentierten Schemas demonstrieren. Er unterscheidet zwei Menschenbilder, die den Führungsstil und die Unternehmensorganisation grundlegend beeinflussen (Lehmann 1991, 167ff):
Theorie 1: Menschen sind "arbeitsunwillig, wenig ehrgeizig, lernunwillig, und verantwortungsscheu". Aus diesem Menschenbild leitet sich ein auf Kontrolle und Überwachung gegründeter Führungsstil ab. Es entsteht eine Organisationsform mit wenig Freiräumen und Verantwortung.
Dieses soeben als grundlegendes Prinzip der fordistischen Fabrik identifizierte Menschenbild ersetzt Lehmann durch
Theorie 2: Der Mensch ist "verantwortungssuchend, auf Erweiterung seiner Möglichkeiten bedacht, eigeninitiativ, kreativ, lernwillig, kooperationsfähig ...". Diesem Menschenbild folgend, bezieht der Vorgesetzte den Mitarbeiter ein. Die Arbeitsorganisation soll Initiative und Engagement fördern. "Freiräume zur weitgehend selbständigen Gestaltung bedeuten Freude an der Arbeit und damit Motivation". Dieser Führungsstil trägt der Auffassung Rechnung, dass "ohne Einbindung der Mitarbeiter in den Führungsprozess ... heute Problemlösungen kaum machbar (sind)".
Aus diesen gegensätzlichen Ausgangspunkten resultieren zwei sich selbst verstärkende Prozesse:
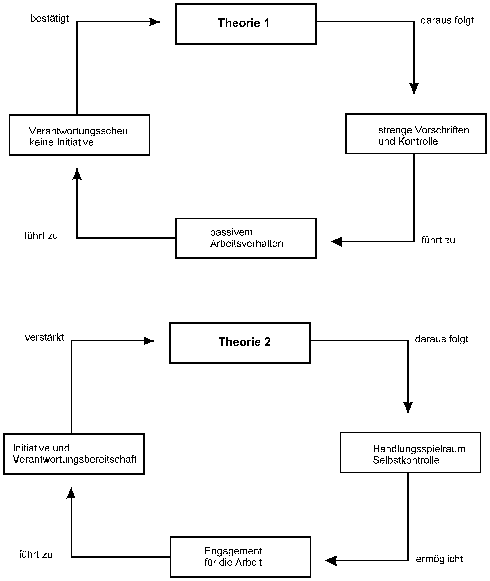
Quelle: ebenda
Theorie 1 zieht einen zur Stagnation und Verkrustung neigenden Prozess nach sich, in dem das negative Bild vom Menschen durch das in der Organisation festgeschriebene passive Arbeitsverhalten bestätigt und verstärkt wird. Das offene, mehrdimensionale Menschenbild in Theorie 2 begründet für Lehmann hingegen einen auf Innovation und Flexibilität ausgerichteten Prozess, der die im Menschen liegenden Potenzen entwickeln hilft und so nicht nur durch ein vermehrtes Engagement sondern auch durch die stetige Verbesserung von Fähigkeiten und Kenntnissen zum Betriebsergebnis beiträgt.
Macht man wie Lehmann Theorie 2 zur Grundlage organisatorischer Überlegungen, so zieht dies einen radikalen Bruch mit hergebrachten Denkschemata nach sich. Vergleicht man neue und alte Formen der Arbeitsorganisation, so fällt dann auch sofort der Abbau verschiedenster Hierarchieebenen ins Auge. War die fordistische Betriebsorganisation durch die strikte Trennung von Konzeption, Überwachung und Ausführung bestimmt, so ist neuen Organisationskonzepten eine zunehmende Integration dieser Funktionen gemeinsam. Wurde schon im japanischen Modell der "atmenden Fabrik" Verantwortung für den korrekten Ablauf der Produktion und die Vermeidung von Ausschuss von der Ebene der Meister und Vorarbeiter auf die der Produktionsarbeit verlagert, so ist die Zusammenfassung früher getrennter Funktionsbereiche heute in vielen Betrieben zur Normalität geworden. Die starre fordistische Kette von Planung, Umsetzung und Kontrolle wird durchbrochen und zunehmend durch abteilungsübergreifende Kooperationen innerhalb des Projektmanagements ersetzt. Der Maxime folgend, dass Probleme dort gelöst werden sollen, wo sie entstehen, sollen Aufgaben so verteilt werden, dass im Idealfalle selbstregelnde Prozesse entstehen, die nur noch mittelbar auf die Direktiven des Managements angewiesen sind. Selbst regeln sollen die Mitarbeiter auch ihre Arbeitszeiten. Galt es in früheren Zeiten, möglichst jede Lebensäußerung zu kontrollieren, um die Arbeitskraft für produktive Zwecke nutzbar zu machen, können viele Mitarbeiter heute, zumindest über den Bereich festgelegter Kernarbeitszeiten hinaus, selbst bestimmen, wann sie ihrer Arbeit nachgehen wollen. Kontrolle wird durch Vertrauen ersetzt, so das Leitmotiv moderner Arbeitszeitmodelle.
Diese neue Souveränität in der Gestaltung der Aufgaben und der Arbeitszeit erfordert dabei im Gegensatz zu tayloristischen Prinzipien ein hohes Maß an Wissen um betriebliche Zusammenhänge. Dies gilt sowohl für die nun autonom agierenden Abteilungen als auch für die einzelnen Beschäftigten. Um selbst planen zu können, welche Tätigkeiten in welchem Umfang zur Realisierung eines bestimmten Ergebnisses erforderlich sind, ist es notwendig, Kenntnisse über alle in diesem Zusammenhang relevanten betrieblichen Vorgänge zu besitzen. Damit muss das alte Prinzip der Zentralisierung von Informationsflüssen zugunsten einer dezentralen Informationsverteilung und –verarbeitung aufgegeben werden. Damit wird die Kommunikation der Beschäftigten, die Abstimmung ihrer Tätigkeiten und Zielsetzungen zu einem wesentlichen Faktor der betrieblichen Organisation. Erforderte die hierarchische Form der Arbeitsteilung lediglich eine vertikale Informationsübertragung von der leitenden Ebene zur ausführenden Stelle (Anweisung) und zurück (Vollzugsmeldung), so müssen dezentral ausgerichtete Strukturen durch eine horizontale Kommunikation zwischen den Mitarbeitern vernetzt werden, denn letztlich sind sie es, die einen reibungslosen Ablauf der verschiedenen Tätigkeiten garantieren müssen. Unabdingbare Voraussetzung der "schlanken Fabrik" ist somit die Aktivierung der Beschäftigten. Ohne die subjektive Engagiertheit, die Bereitschaft zur "totalen Mobilisierung" wären Konzepte des just in time und der lean production nicht denkbar. "In der Fabrik, die auf dem Prinzip der Flexibilität beruht und ‚mit dem Markt atmet‘, ... kann die Arbeitskraft kein ‚träges‘, fremdgesteuertes, statisches Material darstellen. Notwendigerweise muss sie zu einem relativ entwickelten Niveau der Selbstorganisation fähig sein, wenn sie die Signale des ‚Umfelds‘ ... verstehen und darauf mit adäquaten Formen und Modalitäten der eigenen Kooperation antworten soll" (Revelli 1997, 27).
Einen nicht zu unterschätzenden Faktor bildet hier jedoch eine äußere Erscheinung. Heute ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht die gleiche wie zu Zeiten des Fordismus. Stellten während der sechziger und frühen siebziger Jahre Arbeitslosenquoten von 1-2% die Normalität in allen Industriegesellschaften dar, so ist die post-fordistische Ära durch einen beständig hohen Anteil Beschäftigungsloser charakterisiert. Diese Situation verändert das Kräfteverhältnis im Betrieb entscheidend. Konnten Arbeitnehmer in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit eine gewisse Zurückhaltung bei der Arbeit an den Tag legen, ohne mit einer Entlassung rechnen zu müssen, so ist heute der Erhalt des Arbeitsplatzes vielfach an den Nachweis totaler Einsatzbereitschaft gebunden. Der Druck der "industriellen Reservearmee" zwingt jeden einzelnen dazu, sich den Regeln der Produktion zu unterwerfen und immer aufs Neue den Nachweis individueller Profitabilität zu erbringen. Diese Entwicklung wirkt sich höchst negativ auf die Möglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung aus. Gewerkschaftliche Handlungsmacht wurde lange Zeit durch die starke Position der Arbeiterschaft am Arbeitsmarkt stabilisiert. Die Abhängigkeit der Unternehmen vom Faktor Arbeit bot ihrer Interessenvertretung die Möglichkeit, Zugeständnisse zu erzwingen. Konnten die Gewerkschaften gegründet auf einen hohen Organisationsgrad und das Druckmittel des Streiks bis in die Mitte der siebziger Jahre hinein große Erfolge auf ihrem Konto verbuchen, so schwindet ihre Verhandlungsmacht seitdem. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und globalisierten Kapitalverkehrs, in dem eine Verlagerung ganzer Produktionszweige keine Unmöglichkeit mehr darstellt, sind die Waffen der Gewerkschaften stumpf geworden. In Betriebsteilen, die beständig von einer Schließung bedroht scheinen, ist das Instrument des Streiks wirkungslos, Arbeitnehmer ziehen es vor, durch Leistung für ihre Weiterbeschäftigung zu werben, der gewerkschaftliche Organisationsgrad fällt bis heute zum Teil rapide.
Umso erstaunlicher scheint die Entwicklung der betrieblichen Arbeitsbeziehungen. Unternehmer scheinen gleichsam die Positionen der Gewerkschaften, den Arbeitnehmern einen verantwortungsvollen Platz in der betrieblichen Hierarchie einzuräumen, aufgenommen zu haben. Der Monotonie tayloristischer Arbeitsvollzüge setzen sie neue Konzepte der Beteiligung entgegen. Gemeinsames Kennzeichen dieser Konzepte ist das Beiseitetreten des Unternehmers. Er gibt seine unmittelbaren Leitungsfunktionen auf, um den Beschäftigten selbst die Freiräume zu gewähren, die sie für eine sachgerechte Lösung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Fungierte die Unternehmensleitung früher als Mittler zwischen der Innen- und Außenwelt des Betriebes, indem sie die Erfordernisse des Marktes in verbindliche Pläne umgesetzte, sind es heute die Beschäftigten selbst, die ihre Arbeitsweise und Arbeitsleistung möglichst eigenständig an die Erfordernisse der Außenwelt anpassen sollen. Durch die unmittelbare Konfrontation mit den Anforderungen von Kunden (dies können sowohl andere Abteilungen als auch Endabnehmer sein) sollen die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, selbst zu entscheiden, was der Sache angemessen ist. Nicht mehr die Erfüllung von oben gesetzter Planziele, sondern Zielvereinbarungen und Sachgesetze bilden jetzt den Hintergrund, vor dem sich alle Anstrengungen der Mitarbeiter bewähren müssen. Damit sind Erfolg und Misserfolg nun direktes Ergebnis der Aktivitäten einer Abteilung oder eines Mitarbeiters und Verantwortung kann nicht unter Hinweis auf einen zentral gefassten Plan nach oben verschoben werden.
Diese Form der Arbeitsorganisation erfordert auch bei den Beschäftigten einen Mentalitätswechsel. Gefragt ist die Bereitschaft zu unternehmerischem Denken. Da die direkte Verantwortung für das jeweilige Arbeitsergebnis jetzt dem einzelnen Leistungsträger zugeschrieben wird, muss er sich gleichsam als individuelles profit-center am "Markt" bewähren. Doch nicht nur die unmittelbare Tätigkeit wird den Kriterien des Marktes unterworfen. Um langfristig in einer sich immer schneller verändernden Arbeitswelt zurechtzufinden, bedarf es , so jedenfalls die Auffassung vieler industriesoziologischer Arbeiten, mehr und mehr eines lebenslangen Lernens, einer permanenten Investition in das individuelle Humankapital[3]. Als Unternehmer seiner selbst verwertet der Arbeitnehmer dabei seine Arbeitskraft und ist dabei den gleichen Zwängen und Unwägbarkeiten ausgesetzt, wie jeder am Markt tätige Unternehmer[4]. Damit scheint auch hier eine neue Qualität in der Lebensgestaltung erreicht. Gegenüber den starren und lebenslang geltenden Berufsbiographien früherer Jahre stellen sich heutige Arbeitsverhältnisse als durchlässige und flexible Formen dar, in denen es eher möglich erscheint, subjektive Bedürfnisse zu verwirklichen und individuelle Fähigkeiten zu nutzen. Doch auch hier gilt es wie auch schon im Bereich der betrieblichen Autonomisierung zu berücksichtigen, dass die neuen Freiheiten auch mit neuen Zwängen einhergehen, die wiederum durch die Lage am Arbeitsmarkt bedingt sind. In der Industriesoziologie werden diese Entwicklungen daher auch zumeist recht kritisch betrachtet, denn die neue Freiheit in der Wahl von persönlicher Qualifikation und Berufsweg ist zumeist mit der Notwendigkeit gepaart, sich innerhalb eines geringer werdenden Angebotes an Arbeitsplätzen gegen die Konkurrenz anderer Arbeitskräfte durchzusetzen (Voß/Pongratz 1998).
Im Gegensatz zu dieser eher pessimistischen Perspektive wäre ein Gewinn von Handlungsautonomie sowohl im Betrieb als auch am Arbeitsmarkt aus Sicht des ökonomischen mainstream nur zu begrüßen. Der Arbeitnehmer würde nun auch real zu einem rational handelnden Marktsubjekt, dass mit dem gleichen Handlungsspielraum ausgestattet ist und seine Interessen mit einer ähnlichen Vehemenz verfolgt, wie ein selbständiger Unternehmer. Aus diesem Blickwinkel betrachtet scheint eine Annäherung an die modelltheoretisch anvisierte Welt des homo oeconomicus stattzufinden, welche die seit jeher vertretene Ansicht zu bestätigen scheint, dass institutionelle Regelungen des Marktes nur dann einen Sinn haben, wenn sie ein Marktversagen kompensieren können. Soweit der Markt in der Lage ist, die Beziehungen der Menschen zu regeln, sollte ihm aus grundsätzlichen Überlegungen heraus der Vorzug eingeräumt werden[5], denn als rationaler Nutzenmaximierer verwirklicht der Mensch seine Interessen am effizientesten innerhalb marktwirtschaftlicher Beziehungen.
Empirische Befunde
Betrachtet man diese gegensätzlichen theoretischen Auffassungen über die Wirkungen neuer Arbeitsorganisation, so sollte ein Blick auf die realen Verhältnisse Aufschluss darüber geben, welche Folgen sich durch die Umsetzung neuer Organisationsmodelle in der betrieblichen Wirklichkeit ergeben. Leider sind empirische Studien über diesen Themenkreis bis jetzt jedoch nur in geringem Umfang vorhanden(Kotthoff 1997, 166). Auf empirische Daten gestützte Aussagen über die Umsetzung neuer Organisationskonzepte und deren Wirkungen in der bundesdeutschen Ökonomie lassen sich daher nur schwer treffen. Die Bewertung der innerhalb der Betriebswirtschaftlehre und von Unternehmensberatungen entwickelten Konzepte muss bei einem Blick auf die vorhandenen Daten jedoch um einiges differenzierter ausfallen, als dies zumeist innerhalb der akademischen Diskussion geschieht. So lässt eine repräsentative Befragung von Beschäftigten, die von Nordhause-Janz/Pekruhl veröffentlicht wurde, eher eine Polarisierung der Arbeitsformen denn einen allgemeinen Trend in Richtung Neuer Arbeitsorganisation erkennen (Bosch 2000, 253f). In den Jahren 1993 und 1998 wurde die Ausprägung bestimmter Merkmale verglichen, die grob in drei Kategorien zusammengefasst werden können. Wie hoch ist der Grad an Autonomie, welche Partizipationsmöglichkeiten haben die Beschäftigten und wieweit geht die Kooperation innerhalb der Abteilung und des Betriebes? Wenn Mitarbeiter ihre Arbeitsaufgaben selbsttätig gestalten und die Ergebnisse selbst bewerten können, wenn sie bei der Konzeptionierung dieser Aufgaben mitwirken und eingebunden in ein betriebliches Kommunikationsnetzwerk agieren, so wäre dies ein Indiz für die Verbreitung neuer Arbeitsmethoden. Betrachtet man die folgende Grafik, so drängt sich allerdings der Eindruck auf, dass von einer allgemeinen Tendenz zur Umwälzung der Arbeitsorganisation nicht die Rede sein kann.
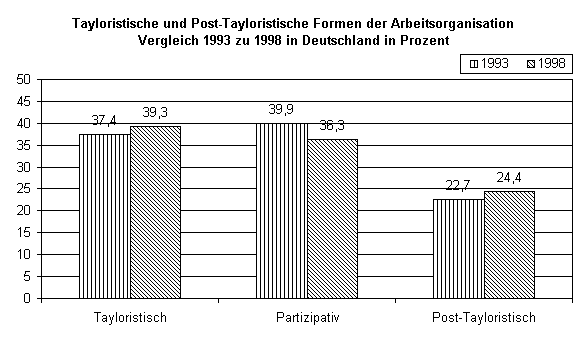
Quelle: Bosch 2000, 254.
In den neunziger Jahren lässt sich sowohl eine Zunahme der tayloristischen als auch der post-tayloristischen Organisationsformen von Arbeit erkennen. Dieses Wachstum vollzieht sich zu Lasten partizipativer Arbeitsformen, die von 1993 – 1998 um 3,6 Prozentpunkte abgenommen haben. So ist im Gegensatz zu vielen veröffentlichten Meinungen in gewissen Bereichen der bundesdeutschen Wirtschaft ein Trend zur Taylorisierung vormals traditionell organisierter Arbeitsverhältnisse zu erkennen wie auch in Bereichen, in denen schon neue Arbeitskonzepte zur Anwendung kamen, oftmals zu alten tayloristischen Methoden zurückgekehrt wurde. Beispiele hierzu geben Telearbeitsplätze in Call-Centres oder die Zerstückelung von Tätigkeiten im Einzelhandel und die Auflösung von Gruppenarbeit in Bereichen der Automobilindustrie.
Handelt es sich bei diesem Bereich der tayloristischen Arbeitsverhältnisse um zumeist niedrig entlohnte Tätigkeiten, so werden in den neuen post-tayloristischen Arbeitsverhältnissen überdurchschnittliche Löhne und Gehälter gezahlt. Beläuft sich der Anteil von Personen, die ihre Arbeit selbstbestimmt und in Kommunikation mit anderen gestalten, mit 24,4% auf rund ein Viertel der Beschäftigten, so beträgt – und das muss gegenüber allen vorschnellen Urteilen zur Ausbreitung neuer Arbeitsverhältnisse immer wieder betont werden – der Anteil der größtenteils fremdbestimmt Arbeitenden immer noch fast 75% der abhängig Beschäftigten. Selbstbestimmtes Arbeiten ist also nur für einen speziellen Teil der Mitarbeiter Realität. Dies gilt sowohl für die angestammte Gruppe der leitenden Angestellten, die noch nie an ein striktes tariflich fixiertes Arbeitszeitregime und genaue Arbeitsvorgaben gebunden war[6], und für die Beschäftigten in einzelnen Branchen der New Economy, im IT-Bereich, der Werbung und in der Automobilindustrie. Von einem allgemeinen Trend zu einer Informalisierung der Arbeitszeiten kann für die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls nicht gesprochen werden. Für leitende und höher qualifizierte Tätigkeiten kann jedoch von einer sukzessiven Durchsetzung neuer Organisationskonzepte und Arbeitsformen ausgegangen werden.
Dabei wächst die Identifikation mit dem Betrieb und der Aufgabe gegenüber früheren mehr auf die individuelle Qualifikation und die Profession ausgerichteten Orientierungen (Kotthoff 1997, 166). Deutlich wird dies in der Aussage eines jungen Betriebswirtes: "Es ist die Politik der Firma, dass man als Neuling schnell mit einer eigenständigen Aufgabe betraut wird, und dass im Gespräch mit dem Vorgesetzten Aufgabenziele definiert werden. ... Und es wird erwartet, dass man sie selbständig löst, dass man sich freischwimmt, und sich auch mit anderen Leuten zusammensetzt, um die Sache auf die Reihe zu kriegen" (ebenda). Man ist bereit, seine Arbeit als wichtigen Teil des Gesamtwerkes zu betrachten und über den eigentlichen Arbeitsbereich hinauszudenken. "Ich überlege mir immer, was kann ich darüber hinaus so ein bisschen mehr einbringen, damit es für die Firma absolut prima ist. Für mich ist ganz klar, ich will mein Wissen in den Dienst der Firma stellen" (ebenda, 167). Diese gewachsene Bereitschaft zur Teilhabe wird vielfach durch demotivierende bürokratische Elemente gebrochen. Aus dem wenigen empirischen Material zur Umsetzung neuer Unternehmenskulturen und Organisationsstrategien ergibt sich der Eindruck, dass es sich hier oftmals um schematische, von oben verordnete Konzepte handelt, die in der betrieblichen Realität ignoriert, nur verzögert umgesetzt oder zumindest so verändert werden, dass das hergebrachte Machtgefüge nicht in Frage gestellt wird (Moldaschl 1997 ; Kadritzke 1997). Die Mitarbeiter scheinen sich in einem Dilemma zwischen einem durch Leitbilder vermittelten individuellen Anspruch und einer betrieblichen Realität zu befinden, die im Grunde immer noch durch eine hierarchisch-autoritäre Organisationsform bestimmt ist.
Neue Arbeitsorganisation und die Bedeutung persönlicher Autonomie
Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus dem bisher Gesagten ziehen? Fördern die neuen Arbeitsverhältnisse einen Wechsel in der persönlichen Einstellung zur Arbeit und hat dieser Wechsel Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter? Ist die neu gewonnene Autonomie ein Garant für die Verwirklichung eigener Interessen? Wie in der Einleitung bereits angedeutet, finden sich in der Literatur zwei völlig gegensätzliche Auffassungen zu diesem Themenbereich, die beide allerdings mehr auf einer theoretischen Ebene angesiedelt und kaum auf empirisches Material gestützt sind. Vergegenwärtigt man sich noch einmal die von Lehmann präsentierte Motivationsspirale, in der die Einsicht in die Motivationsfähigkeit der Mitarbeiter, die Aufnahme ihrer kreativen und problemlösenden Fähigkeiten in ein positives Konzept von Arbeit zu einer Bereicherung der betrieblichen Organisationsstrukturen führt, so liegen neue Organisationskonzepte von Arbeit sowohl im Interesse der Firmenleitung als auch der Beschäftigten. Indem die zuvor unterdrückten Potenzen der Arbeitskraft innerhalb einer schlanken und flexiblen Organisation entfaltet werden, ist es möglich, am Markt durch Kostensenkung und innovative Produkte Konkurrenzvorteile zu erzielen. Doch auch für die Beschäftigten ergeben sich positive Folgen. Sie werden an den Entscheidungen beteiligt, tragen Verantwortung für ihr Tun, sind frei, über ihre Arbeitskraft zu disponieren und können ihre ganz persönlichen Interessen, die sonst auf den Bereich der Freizeit beschränkt waren, nun auch in der Arbeit verwirklichen. Im Gegensatz zum fordistischen Modell wäre damit ein Gleichklang der Interessen hergestellt, der nicht auf die Negation von Subjektivität abgestellt, sondern gerade durch ihre Anerkennung und sinnvolle Einbindung in das betriebliche Geschehen gekennzeichnet ist.
Dies scheinen auch Beobachtungen zu bestätigen, in denen eine gewachsene Identifikation mit der Arbeit festgestellt wird (Kotthoff 1997). Ein wichtiges Indiz bildet hier die Reaktion der Mitarbeiter auf die Abschaffung von Zeiterfassungssystemen. Gemäß der alten Logik des Taylorismus sollte eine fehlende Überwachung der Arbeitszeit dazu führen, dass die Beschäftigten ihre zeitliche Präsenz im Betrieb möglichst zugunsten der Freizeit verringern. Wenn Arbeit ausschließlich durch Mühsal gekennzeichnet ist, dann wird man keinen Moment länger arbeiten, als unbedingt nötig. Festzustellen ist jedoch, dass die Einführung von Vertrauensarbeitszeit in vielen Fällen zu einer Verlängerung des Arbeitstages führt. Ohne Zwang arbeiten die Beschäftigten deutlich länger, als im alten System, kümmern sich nicht um tariflich vorgegebene Arbeitszeiten, sondern fühlen sich der Sache verpflichtet, die scheinbar keinen Aufschub duldet und legen hier ein Engagement an den Tag, dass früher eher Selbständigen zugeschrieben wurde (Glismann 2000).
So wäre durch neue Organisationsformen von Arbeit ein für alle vorteilhaftes Ergebnis erzielt. Doch kommen bei einem näheren Blick auf die konkreten betrieblichen Verhältnisse schnell Zweifel an dieser Vorstellung auf. Zum einen scheint es mit der Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Konzepte einige Probleme zu geben, die unter anderem auf den Widerstand hergebrachter institutioneller Strukturen zurückzuführen sind (Moldaschl 1997). Zweitens empfinden viele Beschäftigte die neue Freiheit vielfach eher als neuen Zwang, der sich in einem inneren Programm der Selbstkontrolle geltend macht, dem sie sich nicht immer ganz freiwillig unterwerfen. So jedenfalls die Meinung gewerkschaftlicher Kritiker, die die Entwicklung schon seit einiger Zeit speziell im High-Tech-Bereich beobachten (Glismann 2000). Vor das Problem gestellt, tarifliche Schutzbestimmungen und Arbeitszeitregelungen plötzlich gegen die Beschäftigten verteidigen zu müssen, stellte sich hier die dringliche Frage, ob das veränderte Verhalten wirklich den Interessen der Mitarbeiter entspräche. In denen von Glismann et. al. bei IBM durchgeführten Email Aktionen stellte sich schnell heraus, dass von einer Verwirklichung eigener Interessen innerhalb der neu gestalteten Betriebsorganisation nur bedingt die Rede sein kann. Zwar empfanden viele Mitarbeiter die gewachsene Verantwortlichkeit für ihren Bereich und die größere Beweglichkeit in der Arbeitsgestaltung als Gewinn, doch wurden gleichzeitig Gefühle des Getriebenseins, der permanenten Überlastung und der sozialen Vereinsamung geäußert.
Für einen außenstehenden Beobachter stellt sich hier die Frage, warum diese negativen Gefühle mit einer Organisationsweise von Arbeit in Zusammenhang stehen, die doch offensichtlich auf die freie Verfügbarkeit des Arbeitnehmers über sein Arbeitsvermögen gegründet ist. Folgerichtig stellte Klaus Peters im Zusammenhang mit der Abschaffung der Zeiterfassung bei IBM die Frage: "Woher weiß ich, was ich selber will?"(Peters 1999). Anders gefragt: kann ein autonom agierender Mensch durch seine Handlungen Verhältnisse erzeugen, die seinen Intentionen derart zuwider laufen, dass er sich plötzlich mit Zwängen konfrontiert sieht, die für ihn alles andere als ein Gefühl von Freiheit aufkommen lassen. Für Peters offenbart sich gerade hier der Herrschaftscharakter neuer Organisationsmodelle. Die Aktivierung des Humankapitals resultiert seines Erachtens aus einer Versachlichung der Herrschaftsverhältnisse im Betrieb. Die personale Kontrolle durch den Vorgesetzten wird ersetzt durch sachliche Zwänge, die sich aus Zielvereinbarungen, Kundenwünschen und Kostenkennziffern ergeben. Im Ergebnis führen die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen durch die Unternehmensleitung und die neue Autonomie der Mitarbeiter für Peters zur Aufrichtung einer autonomen Struktur, die letztlich losgelöst von den Interessen des einzelnen funktioniert und subjektives Handeln durch Sachzwänge leitet (Peters 1997).
In der Diskussion um die neue Arbeitsorganisation scheinen damit explizit zumindest zwei Konnotationen des Begriffs Autonomie zu existieren. Eine dritte – und wie sich herausstellen wird entscheidende - kommt dabei jedoch nur unterschwellig zum Vorschein. Autonom zu sein beinhaltet nach landläufiger Meinung die Chance, unbeeinflusst von äußeren Zwängen zu handeln, eigenen Interessen folgend auf die Umwelt einzuwirken. Innerhalb des vorgestellten Diskussionszusammenhanges ist der Autonomiebegriff jedoch über diese äußerliche Bestimmung von Handlungsfreiheit hinaus auch inhaltlich bestimmt. Autonomes Handeln wird hier als zweckrationales Handeln verstanden. Gerade in der betriebswirtschaftlich orientierten Literatur ist ein deutlicher Bezug zum ökonomischen Handlungsbegriff zu erkennen. Die menschliche Fähigkeit zur rationalen Umsetzung individueller Zwecke wird hier zum Ausgangspunkt jeder weiteren Überlegung gemacht. Die ökonomische Theorie konstruiert dabei eine stringente Verbindung von Handlungsmotiven, geeigneten Mitteln zu ihrer Umsetzung und dem Handlungsresultat. Zusammen mit dem ökonomischen Prinzip, gegebene Mittel möglichst sparsam einzusetzen, entsteht ein Mechanismus, der es erlaubt, unabhängig vom konkreten Handeln realer Personen Aussagen über ihre Rationalität bzw. über rationales Handeln zu machen. Handeln ist in diesem Kontext eindimensional bestimmt. Da es zumeist nur eine effiziente Lösung gibt, verbleibt als einziger Freiheitsgrad das Ziel der Handlung. Doch gerade über diesen Themenkreis vermag der wirtschaftswissenschaftliche mainstream nicht viel Substanzielles auszusagen. Im Allgemeinen überlässt man Spekulationen über die Interessen und Bedürfnisse der Akteure lieber anderen Disziplinen. Man enthält sich bewusst jeder moralischen Bewertung und führt diesen Tatbestand vielfach noch als positive Theorieeigenschaft an, da man so auf unnötigen ideologischen Ballast verzichten könne. Folgt man diesem Handlungsbegriff, kann zwischen dem beobachtbaren Handeln und den Motiven der Akteure keine Differenz auftreten. Da Menschen immer rational agieren und sie nur solche Handlungen ausführen werden, die ihnen letztlich zum Vorteil gereichen, verwirklichen sie in jeder konkreten Handlung ihre Interessen. Bestimmt man Autonomie in dieser Weise, kann die Frage von Peters nach den inneren Beweggründen, die zu einer Differenz zwischen Wollen und Tun führen können, nicht mehr sinnvoll gestellt werden. Im tautologisch bestimmten Begründungsrahmen der Ökonomik ist immer auch gewollt, was getan wird. Folglich kann die Frage nach der Zufriedenheit innerhalb moderner Arbeitszusammenhänge und nach den Möglichkeiten zur Verwirklichung eigener Ziele hier nur mit einem klaren Ja beantwortet werden, denn wie sonst ließe sich erklären, dass zweckrationale Akteure so lange und so engagiert arbeiten[7].
Peters’ Problemstellung zielt offensichtlich auf andere Begriffsebenen. Zum einen kann man darüber nachdenken, ob es neben den Handelnden noch andere Kräfte gibt, die die Handlungssituation determinieren. Strukturelle Elemente wären dann verantwortlich für eine Abweichung von Intention und Handlungsresultat. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die Menschen überhaupt in der Lage sind, ihre Interessen zu formulieren, ob sie soviel innere Autonomie besitzen, um die größer gewordene äußere Autonomie auch ausschöpfen zu können. In seiner Kritik neuer Managementstrategien und betrieblicher Organisationsformen wählt Peters die erste Argumentationsebene. Die Handlungsbedingungen, die durch das Management aber auch durch die Mitarbeiter selbst geschaffen werden, gewinnen gegenüber ihren ursprünglichen Intentionen die Oberhand. Innerhalb der auf Effizienz und Flexibilität ausgerichteten betrieblichen Strukturen agieren sie als funktionale Elemente eines nun reformierten Herrschaftssystems. Folglich sind nicht sie es, die Autonomie erfahren, sondern das Interesse der Unternehmensleitung stellt sich ihnen nun selbst als autonome Struktur gegenüber, die, über Sachzwänge vermittelt, das Handeln bestimmt. Kurz: Man ist frei zu handeln, doch stellen sich die Handlungsbedingungen so dar, dass in Verfolgung eines vermeintlichen Eigeninteresses letztlich die Interessen der Unternehmensleitung verwirklicht werden (Peters 1997, 11ff). "Die Frage heißt, wie muss man die Rahmenbedingungen einer teilautonomen Einheit ... arrangieren, damit diese Einheit darauf von selbst mit Höchstleistung reagiert" (Peters 1997, 18).
Neue Managementkonzepte wären so eine intelligente Methode, die persönlichen Motive und Bedürfnisse der Mitarbeiter profitabel zu funktionalisieren. Doch warum, so lässt sich fragen, gehen diese dann mit einem derartigen Engagement zu Werke? Um zu erklären, warum Mitarbeiter freiwillig gegen ihre eigenen Interessen verstoßen, muss Peters zwingend eine neue Argumentationsebene wählen und zwar die der Ideologiekritik. "die Ziele der Unternehmensführung setzen sich durch in Gestalt des eigenen Willens des einzelnen Arbeitnehmers" (Peters 1999, 7). Will man nicht in ökonomischer Manier Handeln und Motive ineins setzten, muss zwischen "wahren" und "falschen" Interessen unterschieden werden können[8]. Dieses Vorgehen scheinen auch Beobachtungen nahe zu legen, in denen einerseits eine hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter festgestellt wird, andererseits die gleichen Mitarbeiter aber den gewachsenen beruflichen Stress, die ständige Überarbeitung und den Verlust sozialer Kontakte beklagen (Glismann 2000, Schmidt 2000). Doch liegt hier die Gefahr verborgen, mit der Behauptung ideologisch verbrämter Herrschaftsverhältnisse gleichzeitig den Maßstab für eine Bewertung zu verlieren (Zilian 2000, 90). Der Nachweis der Selbsttäuschung lässt sich nicht eben einfach führen und würde eine intersubjektiv verbindliche Theorie er Rationalität erfordern. Doch eine solche Theorie gibt es nicht (ebenda). Wenn die Beschäftigten aufgrund ihrer Befangenheit in ideologischen Verhältnissen selbst nicht mehr angeben können, welche Interessen denn die ihrigen sind und welche ihnen durch die Strukturen aufgenötigt werden, dann können sie zur Klärung der Frage, ob sie durch neue Arbeitsorganisationen zu mehr persönlicher Freiheit gelangen, nicht mehr selbst befragt werden. Mögliche Antworten unterliegen wiederum dem Ideologieverdacht. Daher ist man leicht geneigt, hier mit zugeschriebenen Interessen, mit einem äußeren moralischen Maßstab zu argumentieren, der jedoch kaum durch empirisches Material überprüft werden kann[9].
Verbleibt die Argumentation innerhalb dieser Dichotomie von objektiven, mehr oder weniger absolut gesetzten Moralkriterien und einer zutiefst amoralischen Sichtweise, fällt es schwer, Kriterien anzugeben, mit denen die Situation der Beschäftigten innerhalb neuer Managementstrukturen beschrieben und bewertet werden könnte. Als Konsequenz dieser Einsicht bietet sich nur die Möglichkeit, abseits vom hergebrachten Autonomiebegriff über die Motive und Interessen der handelnden Individuen nachzudenken. Autonomie – und dies erwähnt auch Peters – umfasst als Begriff auch die Frage nach der Handlungsfähigkeit der Akteure. Zumeist wird dieser Aspekt jedoch nur im Sinne von Zurechnungsfähigkeit betrachtet. Wenn man die zur Verfügung stehenden Alternativen einigermaßen rational gegeneinander abwägen kann und imstande ist, eine Begründung für sein Handeln zu liefern, gilt man landläufig als kompetenter Interaktionspartner. Die Frage nach der inneren Autonomie erschöpft sich hier jedoch in der Unterscheidung von rationalem und irrationalem Handeln. Wichtig wäre es an dieser Stelle jedoch zu begründen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssten, damit Menschen in die Lage versetzt werden, ihre Interessen überhaupt zu formulieren. Mit der Erörterung einer allgemeinen Form von Zurechnungsfähigkeit ist diese Aufgabe jedoch noch lange nicht bewältigt. Vielmehr müsste es um die Formen gehen, wie Menschen ihrer Handlungschancen wahrnehmen und wie sie sich selbst innerhalb des betrieblichen Handlungszusammenhangs wahrnehmen. Ohne die subjektive Möglichkeit, diese Zusammenhänge reflektiert zu betrachten, ist jede äußere Form von Autonomie eine inhaltsleere Hülle. Nur durch die Fähigkeit der Akteure zur Formulierung ihrer Interessen kann sie mit Leben erfüllt werden.
Durch die rationalistische Deutung innerer Autonomie wird darüber hinaus jede Form von menschlicher Emotionalität aus der Betrachtung ausgeblendet. Rational zu handeln bedeutet nicht in jedem Falle, mit seinen Gefühlen im Einklang zu stehen. So ist beispielweise die Entscheidung darüber heute länger zu arbeiten, da das laufende Projekt unbedingt bis morgen abgeschlossen sein muss, aus sachlichen Überlegungen durchaus als rational zu bezeichnen. Doch kann von hier aus kein Rückschluss auf die emotionalen Komponenten der Entscheidungssituation gezogen werden. Das schlechte Gewissen gegenüber er Familie oder gegenüber sich selbst, mal wieder keine Zeit zu haben, ist unter dem Aspekt der Zurechnungsfähigkeit nicht zu erfassen, denn auch die Ansprüche, die durch eine reine Sachlogik begründet scheinen, wirken auf der emotionalen Ebene. Auch hier wirken Gefühle von Verpflichtung und einem schlechten Gewissen gegenüber den Kollegen und spielen so eine große Rolle bei der Entscheidung darüber, wie viel Engagement und Zeit für den Betrieb aufgebracht werden (Schmidt 2000). Hier stellt sich die Frage, ob die Akteure auch gegenüber diesen Einflussfaktoren eine ebensolche Freiheit empfinden wie im Hinblick auf die Gestaltung ihrer unmittelbaren Tätigkeit. Sind sie hier in gleicher Weise autonom um ihre eigenen Interessen zu verfolgen und sich nicht dem Diktat emotionaler Zwänge zu unterwerfen? Wie sich die individuelle Situation letztlich darstellt, hängt eng mit der Fähigkeit des einzelnen zusammen, seine eigenen Bedürfnisse innerhalb der äußeren Anforderungen überhaupt noch spüren zu können.
In Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Kaufsucht hat sich der Konsumforscher Gerhard Scherhorn schon vor einiger Zeit mit der Frage beschäftigt, welche Eigenschaften eine autonome Persönlichkeit auszeichnen. Einige Elemente sind aus er folgenden Tabelle zu entnehmen.
Drei Persönlichkeitsbilder nach Scherhorn
|
|
Ursachen |
Merkmale |
|
Autonomie-orientierung "zugewandt" |
Erfahrung
von Akzeptanz |
Selbstvergessenes
Interesse an der Sache oder Person |
|
Kontroll- "aggressiv" |
Erfahrung
des Kontrolliertwerdens (Belohnung, Bestrafung) |
Autoritär handeln |
|
Impersonale Orientierung "angepasst" |
Demotivierende
Erfahrungen |
Mangelhaftes
Selbstvertrauen |
Quelle: Scherhorn 1992, 13.
Die Ursachen für ein bestimmtes Persönlichkeitsmuster liegen Scherhorn zufolge zumeist in einschlägigen Erfahrungen der Kindheit begründet. Ist die Kindheit vornehmlich durch die Kontrolle der Eltern bestimmt und werden die Lebensäußerungen des Kindes je nach Wohlverhalten mit Belohnung und Strafe beantwortet, so wird es auch dem Erwachsenen nicht leicht fallen, im Einklang mit seinen Bedürfnissen zu leben. Sowohl die Kontrollorientierung als auch die impersonale Orientierung zeichnen sich durch ein außengeleitetes Verhalten aus. Hierbei gelingt es kontrollorientierten Menschen jedoch zumeist besser, sich innerhalb betrieblicher Hierarchien durchzusetzen. Die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen beide Gruppen allerdings nur selten, denn ihre charakterliche Prägung beinhaltet zumeist die Suche nach Schuld bei anderen. Erfährt man in der Kindheit dagegen eine vorbehaltlose Akzeptanz, ist der Umgang der Eltern nicht auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sondern ermöglicht es dem Kind eigene Vorlieben und Interessen zu entwickeln, so fällt es auch dem Erwachsenen leichter, mit dem nötigen Selbstvertrauen eine Balance zwischen den eigenen Interessen und denen der Umwelt herzustellen. Innere Autonomie besteht nach Scherhorn wesentlich in der Fähigkeit, eine Situation gelassen und zwanglos zu betrachten und dabei im Wissen um die eigenen Schwächen und Stärken das zu tun, was für einen selbst und die Umwelt das beste ist.
Nun fällt auch diese Bestimmung innerer Autonomie nicht nur wegen der Knappheit der Darstellung recht einseitig aus. Wäre die Ausbildung einer autonomen Persönlichkeit allein an die Erfahrungen der Kindheit gebunden, würde die Verantwortung für das Handeln wiederum an andere abgegeben. Innere Autonomie kann nur in einem aktiven Prozess erlangt werden, in dem die reflexive Bewertung des eigenen Handelns im Vordergrund steht. Reflexion bedeutet hier jedoch immer auch die Auseinandersetzung mit anderen, denn nur durch die kommunikative Spiegelung des Handelns kann der Mensch als Mitglied eines sozialen Gefüges selbstbestimmt agieren. Auch Scherhorn ist nicht der Überzeugung, dass eine vermehrte Autonomieorientierung sich im Zuge des gesellschaftlichen Wertewandels und einer verbesserten Erziehung quasi von selbst entwickelt (Scherhorn 1992, 19) sondern geht eher davon aus, dass die Kontrollorientierung sich bei den meisten Menschen auch in Zukunft durchsetzen wird (Scherhorn 1992, 18). Doch ist er zumindest in der Lage, Hinweise darauf zu geben, was Autonomie im Sinne einer inneren Freiheit bedeuten kann, nämlich eine geringe Abhängigkeit des Selbstwertes von Gütern und Status und die vorbehaltlose Hinwendung auf die Situation. "Solche Zuwendung setzt einen ungefährdeten Selbstwert, also Gelassenheit und Selbstakzeptierung voraus – weder eine hohe noch eine geringe Einschätzung des eigenen Wertes, sondern die unbezweifelte Sicherheit, so akzeptiert zu werden wie man ist, also auch die eigenen Gefühle so akzeptieren zu können wie sie sind" (Scherhorn 1992, 13). Eine in dieser Weise autonome Person sollte jedenfalls besser in der Lage sein, die neuen Freiheiten am Arbeitsplatz auch in ihrem Sinne zu nutzen und den Notwendigkeiten, die sich aus scheinbaren Sachzwängen heraus ergeben, selbstbestimmt zu begegnen.
Im Gegensatz zur herkömmlichen wissenschaftlichen Betrachtungsweise spielt bei der Bewertung neuer Arbeitsverhältnisse der jeweilige Umgang der einzelnen Personen mit den veränderten Verhältnissen am Arbeitsplatz eine bedeutende Rolle. Durch die einseitige Fassung des Autonomiebegriffes verstellen sich jedoch sowohl die ökonomische Theorie als auch Teile der Industriesoziologie den Zugang zu diesem Problemkreis. Indem entweder Handeln und Motivation gleichgesetzt oder mit einem objektiven Interesse argumentiert wird, kann die entscheidende Ebene des subjektiven Erlebens und Reagierens auf die neue Arbeitsorganisation nicht zum zentralen Punkt der Auseinandersetzung gemacht werden[10]. Von hieraus ist es auch zu erklären, warum bis heute kaum Studien zu den persönlichen Folgen des organisatorischen Wandels existieren. Auf einer theoretischen Ebene können zwar einige Anhaltspunkte gewonnen werden, welche Voraussetzungen für einen selbstbestimmten Umgang mit veränderten Handlungsbedingungen gegeben sein müssten, doch kann eine Bewertung der aktuellen Entwicklungstendenzen nur im Rekurs auf die jeweils beteiligten Individuen erfolgen. Ihre Erfahrungen sowie ihre Fähigkeit zu reflexivem Handeln sollten im Vordergrund zukünftiger empirischer Forschung stehen.
Literatur
Bosch, G. (2000): Entgrenzung der Erwerbsarbeit – Lösen sich die Grenzen zwischen Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit auf?, in: Minssen, H. (Hrsg.): Begrenzte Entgrenzungen – Wandlungen von Organisation und Arbeit, Berlin, S. 249 – 268.
Glismann, W. (2000): Ökonomisierung der Ressource Ich – Die Instrumentalisierung des Denkens in der neuen Arbeitsorganisation, in: Denkanstöße, Mai 2000, S. 5 – 24.
Kadritzke, U. (1997): Die Grenzen professioneller Autonomie. Widersprüche moderner Unternehmenskulturen aus der Perspektive qualifizierter Expertenberufe, in: Ders. (Hrsg.): Neue Managementkonzepte zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Berlin, S. 123 – 162.
Kotthoff, H. (1997): Hochqualifizierte Angestellte und betriebliche Umstrukturierung. Erosion von Sozialintegration und Loyalität im Großbetrieb, in: Kadritzke, U. (Hrsg.): Neue Managementkonzepte zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Berlin, S. 163 – 184.
Lehmann, H. (1991): Organisationsentwicklung in Kreditinstituten mit Wertanalyse, in: VDI-Berichte, Unternehmensressourcen für neue Märkte und Produkte aktivieren, Düsseldorf, S. 161 – 180.
Moldaschl, M. (1997): Zweckrationales und reflexives Handeln. Zwei Kulturen des Managementhandelns, in: Kadritzke, U. (Hrsg.): Neue Managementkonzepte zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Berlin, S. 101 – 122.
Monden, Y. (1999): Wege zur Kostensenkung, München.
North, D. C. (1992): Institutionen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen.
Peters, K. (1997): Die neue Autonomie in der Arbeit, DGB-Informationen zur Angestelltenpolitik, 5. 1997.
Peters, K. (1999): Woher weiß ich, was ich selber will?, in: Denkanstöße, Mai 1999, S. 3 – 10.
Revelli, M. (1997): Vom Fordismus zum Toyotismus. Das kapitalistische Wirtschafts- und Sozialmodell im Übergang, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, 4/97.
Schmidt, A. (2000): Mit Haut und Haaren – Die Instrumentalisierung der Gefühle in der neuen Arbeitsorganisation, in: Denkanstöße, Mai 2000, S. 25 – 42.
Scherhorn, G. (1992): Konsumentenverhalten und Wertewandel, überarbeitete Fassung eines Vortrages vom Jahreskongress des Wissenschaftszentrums NRW am 17.11.1992 in Bonn-Bad Godesberg.
Taylor, F.W. (1912) zitiert nach Revelli, M. (1997): Vom Fordismus zum Toyotismus. Das kapitalistische Wirtschafts- und Sozialmodell im Übergang, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, 4/97.
Terberger, E. (1994): Neo-Institutionalistische Ansätze: Entstehung und Wandel, Anspruch und Wirklichkeit, Wiesbaden.
Voß, Günter / Pongratz, Hans J. (1998): Der Arbeitskraftunternehmer – Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft?, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50. Jg., Heft 1, S.131–158.
Williamson, O. E. (1990): Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus, Frankfurt/M. u. a..
Zilian, G. (2000): Taylorismus der Seele, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 25. Jg., S. 75 – 97.
