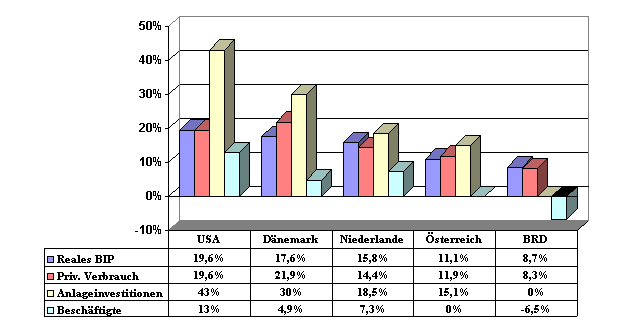
LabourNet Germany | ||||
| Home | Über uns | Suchen | Termine | |
Verfasser:
Dipl. Sozialökonom/Dipl. Volkswirt Christian Christen
Büro Ulla Lötzer (PDS-Bundestagsfraktion)
Jägerstr. 67
10117 Berlin
Tel. 030/227 71444, Fax 030/227 70097
Email: ursula.loetzer@bundestag.de
Zwei Argumentationsstränge, die die „Beschäftigungsmisere“ erklären sollen lauten verkürzt: Zum einen führten zu hohe Löhne oder Lohnnebenkosten in den Industrieländern zur Produktionsverlagerung in sogenannte Billiglohnländer und Kapitalflucht. Was sich u.a. an wachsenden Direktinvestitionen im Ausland ausdrücke. Zum anderen ergebe sich aus den Produktivitätssteigerungen ein hoher Rationalisierungsdruck, der in Verbindung mit der Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft (Tertiarisierung) die Beschäftigungsprobleme verursache. In allen wirtschaftspolitischen Diskussionen werden früher oder später diese Argumente strapaziert, um das Ende der Arbeitsgesellschaft zu verkünden und/oder die Globalisierung zu beschreiben. In diesem Spannungsfeld bewegt sich der folgende Text und versucht, die gängigen Meinungen zu beiden Sachverhalten anhand der realen Entwicklungen zu hinterfragen. Festzuhalten wäre hierbei, dass weder die ökonomische Verflechtung noch Produktivitätsfortschritte sinkende Löhne, den Anstieg der Arbeitslosigkeit oder den Abbau der sozialen Sicherung zwangsläufig erfordern. Trotzdem sind solche Ansichten über den Zusammenhang von Globalisierung und sozialer Probleme inzwischen so verbreitet, dass ohne zu zögern ominöse globale Märkte als Ursache für alle möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Missstände ausgemacht werden.
Die meisten Probleme haben jedoch nach wie vor heimische und in der Regel politische Ursachen und lassen sich meistens ganz banal auf konkrete wirtschaftspolitische Entscheidungen zurückführen. Trotzdem steht hinter dem Totschlagargument „Globalisierung“ ein wirtschaftspolitisches Konzept, ohne dass die gegenwärtige ökonomische Internationalisierung nie möglich gewesen wäre. Wie dies politisch durchgesetzt wurde, darauf kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.[1] Ein Ergebnis der Wirtschaftspolitik, die im Zuge der Globalisierungsdebatte umgesetzt wurde und wird ist, neben aller Ideologie, dass sie eine primäre auf den Export ausgerichteten Wirtschaftsstruktur fördert und für bestimmte Gruppen/Unternehmen von Vorteil ist. Es gibt also eindeutige Gewinner und Verlierer, nicht nur was die Verteilungsverhältnisse betrifft. Hinter dem Begriff Globalisierung stecken somit reale Veränderungen im Verhältnis von Kapital und Arbeit sowie von Politik und Ökonomie. Oder zugespitzt ausgedrückt: „Das Wesen der Globalisierung bildet die Überwindung nationaler und kontinentaler Grenzen, die Auswirkungen der Standortpolitik bestehen in der Wohlstandsmehrung für relativ wenige und in der Verarmung vieler Menschen, verbunden mit einer Tendenz zur Spaltung von Wirtschaft, Gesellschaft und (Sozial-)Staat.“[2]
Dabei ist die Globalisierung kein neues Phänomen und bietet auch keine einmalige historische Chance, wie oft blauäugig verkündet wird. Schaut man auf die Geschichte der kapitalistischen Internationalisierung zurück, so relativiert sich daneben das Märchen von der Unmöglichkeit, die Globalisierung sei nicht aufzuhalten. Sie wurde immer wieder aufgehalten und zwar durch ökonomische Zusammenbrüche, Krisen und Krieg.[3] Die Weltwirtschaftskrise zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildete nur eine der radikalen Zäsuren, die weite Teile der Bevölkerungen in allen Ländern mit massenhafter Verelendung bezahlten. Eine logische Reaktion im Vorfeld der Krisen und im Umgang mit ihren Folgen war deshalb der Versuch, den Kapitalismus sozial zu regulieren. Welche natürlich immer gegen politische Widerstände durchgesetzt werden musste. Es zeigte sich damals bereits deutlich, dass nicht die gesellschaftliche Regulierung der Ökonomie zur Krise führte, wie auch in den aktuellen Kontroversen gerne behauptet wird, sondern das die Regulierung das notwendige Ergebnis des gesellschaftlichen Zusammenbruchs, verursacht durch einen radikalen (liberalen) Marktfundamentalismus, war.[4] Die grundsätzliche Kritik an der Globalisierung versteht sich vor diesem Hintergrund folglich nicht als Absage an internationale Arbeitsteilung, Wissens- und Technologietransfer oder eine international koordinierte Wirtschaftspolitik zur Überwindung der weltweiten Ungleichheit. Kritisiert werden vielmehr die der Globalisierung unterliegenden nationalen und internationalen Konzeptionen, die emanzipatorischen Zielen unversöhnlich gegenüberstehen.
Von einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, wie sie nach 1945 breit diskutiert wurde, wird kaum mehr gesprochen. Statt dessen wird die Globalisierung sehr häufig mit der Steigerung des weltweiten Wohlstands gleichgesetzt. Verfolgte man damals noch Wege, die eine ökonomische und soziale Entwicklung dahingehend ermöglichen sollten, dass sich die globale Ungleichverteilung verringerte oder zumindest nicht vergrößerte, so nimmt man heute die soziale Marginalisierung von fast 80% der Weltbevölkerung mit modernen Phrasen sprachlos hin. Denn alle Zahlen zeigen leider, dass die globalisierte Welt an der alle Teilhaben nur in den Köpfen existiert. Real heißt Globalisierung regionale Konzentration sämtlicher ökonomischer Aktivitäten in den Hauptindustrieländern. Auch das bis vor wenigen Jahren noch prognostizierte asiatische Jahrhundert, welches als positives Beispiel der exportorientierte Entwicklungsstrategie in der Globalisierung galt, gönnt sich erst einmal eine Atempause. Zurückgekehrt sind in schnellerer Abfolge die üblichen Konjunkturzyklen und die Aussicht auf eine deflationäre weltwirtschaftliche Entwicklung, wie bereits vor 1929.
Das dabei die Arbeitslosigkeit steigt, das Arbeitsvolumen der Beschäftigten bei Zunahme der Produktivität wächst und die Löhne stagnieren, ist ebenfalls nicht neu. Mit dem Ende der Arbeitsgesellschaft hat dies nichts zu tun, denn letztendlicher Zweck der Produktion war nie die „Vollbeschäftigung“, sondern der rentable Einsatz der Arbeitskraft. Wird dies Ziel mit weniger Beschäftigten erreicht, ist dies ökonomisch kein Problem. Will die Gesellschaft etwas anderes, so muss sie in den ökonomischen Prozess eingreifen. Anhand aller seriösen Zahlen ist jedoch kaum vom Ende der Arbeit zu sprechen, höchstens vom Ende der relativ „gut bezahlten“ Arbeit mit sozialer Sicherung.[5] Selbst in den OECD-Nationen stieg die Beschäftigung im Durchschnitt um ca. 15%, was einen Zuwachs von 50 Mill. Arbeitsplätzen bedeutete. Das die Löhne weiter sinken sollen und der Ausbau des „Niedriglohnbereichs“ mit Gewinnexplosionen und Produktivitätsfortschritten einhergeht, hat zwar auch etwas mit Globalisierung zu tun. Aber nur insofern, als das u.a. ein Zusammenhang konstruiert wird zwischen der Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses und der Darstellung dieses Prozesses als Weg in die Dienstleistungsgesellschaft. Daraus werden dann Schlussfolgerungen zur Deregulierung der Arbeitsmärkte und der Einführung von Niedriglohnsektoren gezogen.[6] Anpassungen der inneren sozialen und ökonomischen Verhältnisse gelten folglich als zwingend bzw. alternativlos, um diesen abgeleiteten Anforderungen der Globalisierung gerecht zu werden.
Im folgenden Text wird versucht, den Begriff der Globalisierung etwas genauer zu erfassen und einige Zusammenhänge zwischen der Globalisierung, wirtschaftspolitischen Entscheidungen und ihren Effekten auf die Beschäftigungsentwicklung, aufzuzeigen. Im ersten Abschnitt wirddazu auf grundlegende ökonomische Zusammenhänge von Investition, Kapitalknappheit und -überfluss und den wirtschaftspolitischen Veränderungen (Stichwort: Exportorientierung) eingegangen. Diesem folgt im zweiten Abschnitt die Darstellung der Globalisierung anhand von Eckpunkten bezüglich der Warenströmen und der Funktion ausländischer Direktinvestitionen. Es geht darum zu klären, warum es eine ökonomische Verflechtung gibt, mit wem sie besteht und was Globalisierung eben nicht ist. Abschließend werden im dritten Abschnitt binnenwirtschaftliche Veränderungen behandelt. Dabei werden die Aspekte des Strukturwandels und der Produktivitätsentwicklung mit Entwicklungen auf dem englischen und amerikanischen Arbeitsmarkt verbunden, da diese häufig als positives Beispiel für die „negativen Verhältnisse“ in Deutschland dienen.
Zur eingehenderen Analyse des Zusammenhangs von Globalisierung und binnenwirtschaftlicher Entwicklung wird auf die verwendete Literatur verwiesen und auf weitere Diskussionspapier „vertröstet“. Unvollständigkeit erscheint mir aber weniger problematisch zu sein, als falsche Behauptungen der gegenwärtigen Entwicklungen zu präsentieren und sich in einem Diskurs über Chancen und Möglichkeiten der Globalisierung zu verlieren. Das kann man natürlich auch machen, wenn man glaubt, zu den Gewinnern zu gehören und überzeugt ist, das sich das System der ökonomischen und sozialen Ungleichheit auf Dauer halten kann.
Das der gesamtwirtschaftliche Output und die betriebswirtschaftliche Wertschöpfung ständig steigen zeigen alle Zahlen. Das gleichzeitig die Löhne und Gehälter stagnieren, die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau verbleibt und die Sozialleistungen zurückgefahren werden ist ebenso offensichtlich. Für jeden, der sich eingehend mit der Kritik der politischen Ökonomie auseinandergesetzt hat, ist dies nicht neu und entspricht der Funktionslogik des Kapitalismus. Trotzdem ergeben sich Veränderungen in dem der kapitalistischen Logik innewohnenden Prozess der gleichzeitigen Produktion von Reichtum und Armut.[7] Seit Mitte der 70er Jahre verschärft sich dieser Widerspruch, wobei die wirtschaftspolitische Ausrichtung auf die Globalisierung zusätzliche Aspekt mit sich bringt. Zu Fragen wäre also, wo der Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen liegt und welche wirtschaftspolitischen Veränderungen sich ergeben haben?
Hinter dem verkürzt dargestellten Widerspruch der Zunahme von Armut und ökonomischer Stagnation verbirgt sich ein altbekanntes Problem jeder entwickelten Wirtschaft, die Unterkonsumption. D.h., in den modernen Industrienationen ist nicht mehr die absolute Kapitalknappheit das Problem für die weitere Entwicklung und das Wachstum, sondern der relative Kapitalüberfluss behindert, neben den politischen Widerständen, den gesellschaftlichen Fortschritt. Auf den ersten Blick erscheint dies paradox, denn es entspricht so gar nicht der landläufigen Meinungen über die Gründe der wirtschaftlichen Krise. Diese wird vor allem auf mangelndes Investitionskapital aufgrund zu geringer Gewinne/Umsätze zurückgeführt. Was betriebswirtschaftlich durchaus begründet sein kann oder für strukturschwache Regionen gilt, hat gesamtwirtschaftlich hingegen fast keinen empirischen und theoretischen Erklärungswert. Eine ungleiche Entwicklung, die sich in relativer Kapitalknappheit von Unternehmen und/oder Regionen ausdrückt, ist seit Beginn der Industrialisierung bekannt. Dies Problem ist einzig durch gezielte Förderung und wirtschaftspolitische Steuerung zu überwinden, wie durch die unterschiedlichsten Formen der Industrialisierung beispielsweise Deutschlands, Italiens, der Sowjetunion oder der asiatischen Schwellenländern historisch belegt ist.
In allen Fällen nachholender Industrialisierung zeigen sich dabei die gleichen Aspekte, die bereits den klassischen Kapitalismus kennzeichneten: Solange, wie die Arbeitsproduktivität und damit der Unterschied zwischen dem Produktionsoutput und dem Lohn je Beschäftigten noch gering, der Bedarf an Realkapital für die nachholende Industrialisierung aber noch sehr hoch ist, muss das Problem der Kapitalknappheit gelöst werden. Investitionslenkung, Preisadministration, staatlich verordnete Lohnzurückhaltung und vieles mehr wurden und werden dafür eingesetzt. Im günstigen Fall stellt sich ein hohes Wachstum und eine starke wirtschaftliche Dynamik ein, wie auch in den asiatischen Schwellenländern zu beobachten war. Gerade dies hatte nichts mit einer überlegenen asiatischen Kultur oder sonstigen Mythen von einer globalisierten Wirtschaft zu tun, sondern ist schnöde ökonomische Logik. Eine gute historische und theoretische Kenntnis ökonomischer Zusammenhänge schützt dabei vor Neuentdeckung alt bekannter Sachverhalte.[8]
Anders stellt sich das Problem der Entwicklungsschranken in den Gesellschaften dar, in denen die Akkumulation des Kapitals so weit fortgeschritten ist, das es keine absolute Kapitalknappheit mehr gibt. Die Arbeitsproduktivität steigt dort auf einen hohen Wert, der Kapitalbedarf für Investitionen sinkt relativ zu den vorhandenen Mitteln und die Produktionsverhältnisse verhindern einen ständigen Zuwachs des Massenkonsums. Das Wachstum verlangsamt sich trotz Produktivitätsfortschritt und die Investitionen in Realkapital gehen zurück, was zur Arbeitslosigkeit führt. Der Mangel an Konsumgüternachfrage und die fehlende Transformation des Mehrprodukts in gesellschaftlichen Fortschritt, für Arbeitszeitverkürzung, eine bessere soziale Sicherung, steigende Ausgaben für Kultur, Bildung, Umweltschutz, sind damit die Entwicklungsschranken des Systems. Die modernen Gesellschaften leben also nicht über ihre Verhältnisse, sondern nutzen ihre ökonomischen und sozialen Möglichkeiten nicht und fallen ständig hinter das bereits erreichte sozioökonomisches Niveau zurück.
Das Produktionsergebnis, wenn es nicht für die Investitionen genutzt oder als Massenkonsum verbraucht wird, könnte also entweder durch die Haushalte der Gewinnbezieher und hoher Lohneinkommensbezieher, durch den Staat (Haushaltsdefizite) oder durch Exportüberschüsse (Konsum des Auslands) genutzt werden. Staatsdefizite zur Absorption der Überschüsse gelten gegenwärtig als „Sünde“ und werden durch die Haushaltskonsolidierung bekämpft. Wie aber dann beispielsweise die Angleichung unterschiedlicher Lebensverhältnisse oder ein sozial-ökologischer Umbau finanziert und umgesetzt werden soll, bleibt ungeklärt, denn der Markt hat dies nicht als Ziel. Bis vor gut 20 Jahren wurde folgende ökonomische Binsenweisheit breit akzeptiert: Die Aufgaben des Staates beziehen sich gerade nicht auf die Felder, die von Privatpersonen oder Unternehmen abgedeckt werden, sondern jene Funktionen, die über den privatwirtschaftlichen Kreis hinausgehen, die also keiner erfüllt, wenn sie nicht eine gesellschaftliche Institution (der Staat) übernimmt. Der Verzicht auf eine makroökonomische Politik zur Erfüllung dieser Aufgaben bedeutet deshalb nicht, dass private Akteure oder der Markt an die Stelle des Staats treten und diese Aufgaben übernehmen. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass die Aufgaben überhaupt nicht mehr erledigt werden.
Der Konsum der Gewinnbezieher oder hoher Lohneinkommensbezieher wiederum fällt aus anderen Gründen aus: Es existiert eine hohe Sparquote durch Sättigungstendenzen bezüglich des Verbrauchs materieller Güter. Einzig im Bereich der persönlichen Dienstleistungen scheint ein (kurzfristiges) Wachstumspotential zu bestehen. Die Diskussionen über die Dienstleistungslücke, die Ausdehnung dieses Sektors mittels Kombilohn oder die generelle Diskussion um die Lohnhöhe hat hier einen Bezugspunkt. Möglicherweise kann eine solche Politik für eine bestimmte Zeitspanne zu mehr Beschäftigung führen. Aber ob dies die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt erhöht und/oder sozial abgesicherte Arbeitsplätze entstehen, ist zu bezweifeln. Vielmehr erscheint die Stagnation der Masseneinkommen und damit erneut ein Nachfrageausfall vorprogrammiert.
Tab. 1: Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), durch. Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr
|
Privater Verbrauch |
Staatsverbrauch |
Ausrüstungs- |
|
|
1960-1970 |
+7,9 |
+10,2 |
+9,3 |
|
1970-1980 |
+8,5 |
+10,8 |
+6,8 |
|
1980-1990 |
+4,7 |
+4,1 |
+6,3 |
|
1992 |
+7,7 |
+10,7 |
-1,6 |
|
1993 |
+4,2 |
+3,0 |
-13,4 |
|
1994 |
+4,2 |
+3,7 |
-1,3 |
|
1995 |
+3,6 |
+4,2 |
+1,6 |
|
1996 |
+3,6 |
+2,7 |
+2,1 |
|
1997 |
+2,4 |
-0,2 |
+4,3 |
|
1998 |
+2,9 |
+1,0 |
+9,9 |
Quelle: Sachverständigen Gutachten 1998
Abb.1) Verwendung des BIP im internationalen Vergleich (Veränderung 1991-1997)
Quelle: SVR-Gutachten 1998
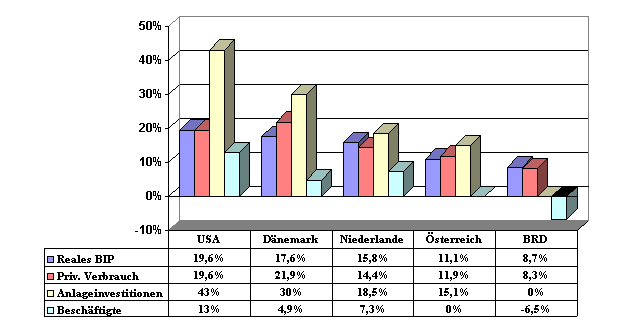
Bleibt also der Exportsektor zur Absorption des steigenden Mehrprodukts, worauf auch die Politik seit mehr als 20 Jahren setzt. Alles wird unternommen, um die Lohnstückkosten zu senken und sich damit gegenüber den Wettbewerbern auf den Weltmärkten durchzusetzen.[9] Die Exportüberschüsse müssen so hoch ausfallen, dass sie die Beschäftigungsminderung aufgrund unzureichender kaufkräftiger Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen im Inland kompensieren. Dies funktioniert nur so lange, wie die Preisvorteile durch gesunkene Lohnstückkosten, verbesserte Währungsrelationen, niedrige Transportkosten etc. nicht durch entsprechende Maßnahmen der Handelspartner neutralisiert werden.
Aber genau das geschieht, denn die Exportorientierung gilt für alle Nationen als Konzept, um die heimische Wachstumsschwäche zu überwinden. Auf die Dauer ist diese Politik also ein Nullsummenspiel. Das dabei ständig die Produktivität erhöht wird[10] und das Wachstum durch die Politik der Exportorientierung nach innen weiter zurückgeht, verschärft das Problem der Unterkonsumption im inneren und führt zu deflationären Tendenzen im internationalen Maßstab. Schon alleine die Erwähnung des Begriffs der Unterkonsumption in diesem Zusammenhang rüttelt jedoch an einem wirtschaftspolitischen Tabu, denn damit wird behauptet, „...dass Armut in entwickelten kapitalistischen Ländern angesichts des Standes der Produktivkraftentwicklung eigentlich vermeidlich ist, was Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen produziert wird, und damit die Forderung nach Reform auslöst.“[11]
Zu klären ist also die Frage, warum die überschüssigen Mittel nicht für Investitionen genutzt werden? Zunächst einmal heißt Investition nicht generell Investition in Beschäftigung oder Realkapital. Für die Produktion ist zu unterscheiden in Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen, sowie Investitionen in Prozess- und Produktinnovationen. Sind die Erwartungen getrübt und die bestehenden Kapazitäten nicht ausgelastet, so wird es zu keinen Erweiterungen kommen. Das hauptsächliche Investitionsmotiv deutscher Unternehmen ist die Rationalisierung gefolgt von Ersatzinvestitionen und Produktinnovationen, alle drei Motive führen nicht unbedingt zur Beschäftigungssteigerung. Kapazitätserweiterung und Investitionen im Umweltschutz, eine der unterstellten Wachstumsbranchen mit hohen Beschäftigungseffekten, liegen auf den hinteren Rängen.[12] Bei einer Kapazitätsauslastung zwischen 81% (Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) und 88% (Investitionsgüterproduzierendes Gewerbe) können darüber hinaus kurzfristige Nachfragesteigerungen ohne weiteres bedient werden.[13] Der reine Ersatz von Maschinen erhöht in dieser Situation einzig die Produktivität, so dass die Rationalisierung (Stellenabbau durch Prozessinnovationen) möglich wird, ohne das in anderen Bereichen zusätzlich Beschäftigung aufgebaut wird. Zur Entwicklung gänzlich neuer Produkte wird hingegen viel Kapital benötigt, das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht ohne weiteres von den Kreditinstituten zur Verfügung gestellt wird.
Was heißt das konkret? Ein Beispiel wäre die Massenproduktion von Solarzellen um ihre Stückkosten massiv zu senken, damit die Nachfrage stiege und der damit produzierte Strom kostengünstig anzubieten wäre. Alles in allem ein großes Investitionsprojekt. Der Kapitalbedarf wäre aller Wahrscheinlichkeit so hoch, dass eine Finanzierung durch die öffentliche Hand teilweise oder ganz stattfinden müsste. Unter den heutigen Bedingungen wird dieses Engagement, sei es über Kredite oder Steuermitteln, aber abgelehnt. Von der Privatwirtschaft wird dies Großprojekt auch nicht umgesetzt, da das gebundene Kapital in der konventionelle Energieerzeugung noch einige Jahrzehnte genutzt werden soll. Eine dementsprechende Kapitalentwertung, die durch den Aufbau einer wirklich massenwirksamen alternativen Energieerzeugung einsetzen würde, wird logischerweise vermieden. Industriepolitik, die den Namen verdient, muss sich somit immer mit den strukturellen Bedingungen auseinandersetzen, die durch die bereits bestehende Form der Produktion gesetzt sind. Vertrauen in die Marktkräfte hilft dabei nicht weiter.
Kommen wir aber zurück zur Ausgangsfrage. Selbstverständlich werden die in den Unternehmen verbleibenden Mittel für mehr als nur Rationalisierung- und Ersatzinvestitionen genutzt. Den größten Anteil daran haben aber Investitionen in Beteiligungen und Fusionen, Finanzanlagen oder zur Erschließung ausländischer Märkte.[14] Ein zentraler Aspekt der Globalisierung, der nationale Strukturen nachhaltig verändert und auf den später eingegangen wird. Auch damit kann Beschäftigung im Heimatland gesichert werden. Der Verlust von Arbeitsplätzen wird so aber auch nicht aufgefangen, denn die getätigten Investitionen genügen dem Umfang und der Art nach nicht, um den gesamten Kapitalbestand zu absorbieren und in gesellschaftlichen Fortschritt für alle umzuwandeln. Bestätigt wird diese Aussage durch die Ausstattung der Unternehmen mit Eigenkapital und den täglichen Umsatz an den Finanzmärkten. Hier widerlegt die Realität täglich die Behauptung, dass zu wenig Mitteln für Investitionen vorhanden wären.
Anhand der Kapitalströme und des Investitionszwecks beschreiben die Zahlen das Verhalten der Unternehmen mit dem grundsätzlichen Problem, dass sich ab einem gewissen Entwicklungsstand immer einstellt: Schon alleine der Erhalt eines gegebenen Beschäftigungsniveaus bei konstantem Lohnsatz und steigender Arbeitsproduktivität erfordert eine Investitionsquote, die gegen 1 (100%) strebt. Zwar hat dieser mathematische Grenzwert keine praktische Bedeutung, aber damit läst sich das Problem entwickelter kapitalistischer Länder auf den Punkt bringen. Tatsächlich zeigt sich nämlich, dass die Investitionsquote einen Bruttowert von 25% nicht überschreitet, sondern der Tendenz nach im Zeitverlauf sinkt.[15] Damit hat die Investitionsquote in den entwickelten Ländern eine Obergrenze, die auch nicht aufgehoben werden kann, nur weil mehr Mittel beispielsweise durch stärkeres Sparen zur Verfügung gestellt werden. D.h., stagnierende Reallöhne bei steigender Arbeitsproduktivität, einer Umverteilung von oben nach unten (steigendes Sparen) und einer Exportorientierung erzeugt auf der einen Seite Kapitalüberschüsse, denen rentable Anlagemöglichkeiten fehlen und unter den gegenwärtigen Bedingungen gleichzeitig ein Abbau von Beschäftigung und den sozialen Rückschritt. Das ist ein primärer Zusammenhang von Globalisierung und Beschäftigung, der im weiteren vertieft werden soll.
Es sollte etwas klarer geworden sein, dass die wirtschaftliche Ursachen der Probleme auf dem Arbeitsmarkt im Binnenbereich liegen. Diese können wiederum auf Veränderungen zurückgeführt werden, die sich mit der wirtschaftspolitischen Weichenstellung zu Gunsten einer Exportorientierung ergeben. Die Hinwendung zum „Weltmarkt“ begünstigt die Produktion für den Export, verschärft die Konkurrenz auf den Märkten, führt zum Verdrängungswettbewerb und wird nach innen als Druck zur Veränderung der Verteilungsverhältnisse bzw. zum Abbau des Wohlfahrtsstaats und seiner binnenwirtschaftlichen Grundlage genutzt. Zentrales Kriterium der Wirtschaftspolitik ist, dass nationale Unternehmen international erfolgreich expandieren. D.h. sie sollen zu Global Playern werden und/oder sich auf den ausländischen Märkten behaupten. Die Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit heißt konkret:
Die Ziele Kostensenkung und Geldpolitik sind dabei auf widersprüchliche Weise miteinander verbunden. Einerseits erfordert die Exportorientierung, dass der Wert der Währung (DM oder Euro) nicht überproportional steigt, denn sonst verteuern sich die Produkte (in Relation zur Fremdwährung) und die Exporte gehen zurück. Dies zeigt sich auch bei der Entwicklung der Lohnstückkosten, die nämlich stärker als von den Lohnverhandlungen durch die Währungsrelation bestimmt werden: Im Zeitraum von 1988-1996 ergab sich laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ein Nachteil bei den Lohnstückkosten gegenüber den Konkurrenten von 20%, die auf zu hohe Lohnsteigerungen zurückgeführt wurden. Das Ifo-Institut aus München kam jedoch zu einem anderen Ergebnis und führte dies auf die Erhöhung des Werts der DM gegenüber dem US-Dollar zurück.
Auch das IW musste schließlich dieser Erklärung zustimmen. Trotzdem hielt das Arbeitgeberlager an der Schlussfolgerung fest, die Löhne sind zu hoch. IW-Direktor Gerhard Fels verdeutlichte auch warum, denn seiner Ansicht nach könne es nicht angehen, dass die Aufwertungswirkungen alleine den Arbeitgebern aufgebürdet werden. „Diese Forderung ist absurd, denn in den letzten 20 Jahren hat die Mark gegenüber dem Dollar im Schnitt 2,6 Prozent pro Jahr an Wert gewonnen. Wollten deutsche Arbeitnehmer tatsächlich diese Wechselkurssteigerung durch geringe Löhne auffangen, so müssten sie jedes Jahr 2,6 Prozent weniger in der Lohntüte haben als ihre amerikanischen Kollegen. In den USA lag die Lohnsteigerung durchschnittlich bei 5,0 Prozent pro Jahr. Um die deutschen Unternehmen, wie es Fels fordert, von der Wechselkursentwicklung zu entlasten, dürfte die Lohnerhöhung hierzulande also nicht höher ausfallen als 2,4 Prozent (5,0 Prozent US-Steigerung abzüglich 2,6 Prozent D-Mark-Aufwertung). Diese Steigerung läge jedoch deutlich unterhalb der deutschen Inflationsrate in jenem Zeitraum von etwa 3,2 Prozent pro Jahr. Eine solche Lohnpolitik würde also zu einem Kaufkraftverlust von jährlich knapp einem Prozent führen.“[16] Anders ausgedrückt bedeute dies eine reale Lohnkürzung um ca. 20% im Vergleich zum Jahr 1975. Dieser Nachfrageschock würde den Binnenmarkt vollends in die Krise stürzen, was scheinbar billigend in Kauf genommen wird. Es steckt wohl eher etwas anderes hinter der ganzen Diskussion. Denn so dumm ist natürlich auch die Arbeitgeberseite nicht, dass sie ihren eigenen Untergang organisiert. Aber über den Umweg der Lohnstückkostendiskussion lassen sich Lohnsenkungen oder soziale Kürzungen allemal besser „verkaufen“, als durch einen direkten Angriff auf die Lohnhöhe.
Gleichzeitig wird jedoch eine starke Währung verlangt und durch die Geldpolitik erzeugt, damit deutsche Unternehmen im Ausland erfolgreich „einkaufen“ können. Oder anders gesagt: Ausländische Direktinvestitionen deutscher Unternehmen zur Erschließung ausländischer Märkte oder für Fusionen und Firmenkäufe erfordern eine starke Währung, denn damit Sinken die Kosten für das deutsche Kapital. Gerade durch die Liberalisierung der Finanzmärkte ist die Forderung nach einer harten Währung (geringer Inflation) und hohen Zinsen (damit ausländische Kapital nach Deutschland fließt) zentraler Bestandteil der exportorientierten Wirtschaftspolitik. Sie muss nämlich nicht nur die Herstellung und den Handel von Gütern unterstützen, sondern immer auch den Anforderungen des Finanzkapitals genügen. Interessenkonflikte sind dabei unumgänglich. Wie diese politisch gelöst werden, hängt von der ökonomischen Macht der Unternehmen, Institutionen und Personen ab.
Dritter Effekt einer starken Währung sind die sinkenden Preise für Güter, die in die Bundesrepublik importiert werden. Je nach Importintensität der Produktion, also wie viele Vorprodukte aus dem Ausland zur Herstellung einer Waren benötigt werden, sinken in verschiedenen Sektoren die Kosten für ihre materiellen und immateriellen Vorleistungen. Dies waren nur drei Effekt unterschiedlicher Währungsrelation, die sich auf den Binnenmarkt und die Beschäftigungsentwicklung auswirken. Daneben bestehen noch andere, auf die hier nicht eingegangen werden kann.[17] Es sollte aber deutlich geworden sein, dass Fragen zur Unabhängigkeit der Zentralbank, der Stabilisierung der Währungen und der Zinshöhe wesentliche Elemente einer exportorientierten Wirtschaftspolitik sind.
Trotz Expansion ins Ausland und der Ausrichtung auf den Export sind die Unternehmen stark an den nationalen Standort gebunden. Eine vollkommene Mobilität oder absolute Internationalisierung der Wertschöpfung, sprich der Produktion, gibt es nicht. Jede nationale Politik einer auf den Export ausgerichteten Wirtschaftsstruktur muss folglich immer die Forderung nach Lohnsenkung, die Beschränkung der Sozialabgaben, Steuersenkung und Deregulierung bzw. Abschaffung von Vorschriften zum Umwelt-, Arbeits- und Kündigungsschutz beinhalten. Sonst können die Gewinnerwartungen und die Kapitalrentabilität auf dem heimischen Markt, bei stagnierenden Kaufkraft, nicht erfüllt werden. Dies ist aber ökonomisch zwingend notwendig, da auf dem Binnenmarkt 70-80% des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet werden. Kein Unternehmen kann sich dieser Realität entziehen. Daneben dient diese politische Regulierungen im Inneren der Erhöhung der Attraktivität des Finanzstandortes, damit ausländisches Kapital angezogen und einheimisches Kapital nicht abgezogen wird. Gerade die durch den liberalisierten Kapitalverkehr in ihrer Bedeutung stark gewachsenen Investitionen in Finanzanlagen und das Prinzip des Shareholder Values sind ein starkes Druckmittel, eine Geldpolitik für einen stabilen Geldwert durch hohe Zinsen, Geldmengenverknappung und niedrige Steuern[18] zu erzwingen. Deshalb wird für eine weitere Liberalisierung des Kapitalverkehrs gestritten, da dies erstens die Gewinnerwartungen und die Stabilität des in Finanzanlagen investierten Kapitals befriedigt und zweitens den Spielraum, um Kapital besser und schneller abziehen zu können, erhöht.
Zusammengenommen verursachten dies Veränderung der Wirtschaftspolitik, wie sie noch bis Mitte der 70er Jahre verfolgt wurde: Weg von einer binnenwirtschaftlichen Belebung durch Wachstum, Beschäftigungszuwachs, Erhöhung der Masseneinkommen und Ausbau der sozialen Sicherung in Verbindung mit einem aktiven Wohlfahrtsstaat hin zur Antiinflations und Sparpolitik, die Preisstabilität als höchstes Ziel ansieht und eine permanente Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mittels eines aktivierenden Wettbewerbsstaat umsetzt. Das ist im wesentlichen gemeint, wenn von einer exportorientierten Politik gesprochen wird bzw. wie sich die Globalisierung in Realpolitik übersetzt.
Im folgenden Abschnitt werden nur einige Daten zum Handel, speziell den Exporten aus der Bundesrepublik, und zur Funktion der durch deutsche Unternehmen getätigten ausländischen Direktinvestitionen präsentiert. Ziel ist, die Folgen der strukturellen Veränderungen, die sich durch eine primäre Ausrichtung der Volkswirtschaft auf den Export ergeben, zu skizzieren. Die Eingangs erwähnte These von der Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer, die als Ursache für die steigende Arbeitslosigkeit bei uns immer wieder angeführt wird, soll dabei ebenfalls anhand aggregierter Daten überprüft werden.
Aufzuräumen ist zunächst mit einem Mythos: Von einem weltweiten Handelssystem, das immer in der Diskussion über die Globalisierung auftaucht, kann nicht gesprochen werden. Der Handel vollzieht sich vor allem zwischen den hochentwickelten Industrienationen. Die Entwicklungsländer fallen hingegen aus dem Welthandel heraus. Nur einige wenige Schwellenländer konnten sich im globalen Handel in den letzten 30 Jahre etwas behaupten und von seinem Wachstum profitieren. Sieht man sich die Struktur der gehandelten Produkte an, so wird auch deutlich, warum die Mehrzahl der Länder beim Handel marginalisiert wird: Die weltweiten Exporte bestehen zu ca. 90% aus Industrieprodukten (Fertig- und Halbfertigwaren). Der intra-industrielle Handel macht dabei ca. 2/3 der gesamten Exporte aus. D.h., der Handel zwischen gleichen Unternehmen in verschiedene Ländern und mit industriellen Vor- und Endprodukten ist Kern des Warenstroms, was die internationale Arbeitsteilung fördert. Eine Unterscheidung in Produkte, die nur für den Export hergestellt werden und Produkte, die nur für den Binnenmarkt produziert werden lässt sich damit nicht treffen, denn es werden die „gleichen“ Waren gegeneinander getauscht.
Der Welthandelbelief sich1997 (berechnet nach den Ausfuhren) auf 5467 Mrd. US$, wobei die USA und die Bundesrepublik den höchsten Ausfuhranteilen hielten: 1997 betrugen diese für die USA ca. 13%, für die BRD ca. 10%. 1999 stiegen die Werte für die USA auf ca. 15,6%, für die BRD auf ca.11%. Mit geringen Ausschlägen bewegen sich die Zahlen seit Beginn des 20. Jahrhunderts in diesen Relationen.
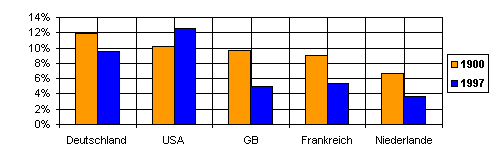 |
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (1999): Deutschland 2000 – Wandel, Wachstum, Wohlstand; Statistisches Bundesamt 1999
Eine Verschlechterung der deutschen Position im Handel z.B. durch zu hohe Kosten am Standort Deutschland, ist nicht zu belegen. Ganz im Gegenteil ist ein permanenter Anstieg des Ausfuhrüberschusses, die Differenz zwischen den Im- und Exporten, in den letzten Jahren zu verzeichnen (siehe Abb. 3). Dabei hat die Bundesrepublik mit allen Ländern, außer Japan, Überschüsse. Sie exportiert also mehr, als sie aus den übrigen Ländern importiert. Der Export betrug 1997 insgesamt fast 1 Billionen DM (886 776 Mrd.). Ca. 61% (540016 Mrd.) entfielen auf Europa, wobei sich dies aus EU (491 647 Mrd.) und EFTA (48 369 Mrd.) zusammensetzt. Die NAFTA ist der nächst größte Handelspartner. Hier wurden ca. 10 % (88 727 Mrd.) aller deutschen Waren abgesetzt. Aber auch hier gibt es eine klare regionale Konzentration, denn alleine der Anteil der USA betrug ca. 9% (76 617 Mrd.). Der Export in die ASEAN Staaten betrug 1997 nur ca. 3% (23 657 Mrd.). Die direkten Auswirkungen der Asienkrise auf den Export konnten deshalb relativ gut verkraftet werden. Auf den gesamten Rest der Welt entfielen, mit starker regionaler Konzentration, ca. 26% (234 376 Mrd.).
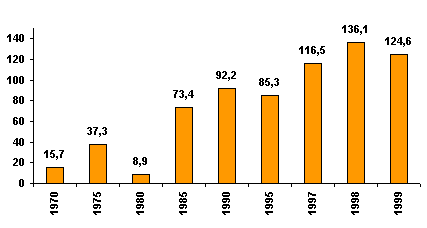 |
Um den Außenbeitrag der Exporte zum Bruttosozialprodukt für 1997 zu erhalten müssen die 886 776 Mrd. DM zum Bruttosozialprodukt (BSP) in Höhe von ca. 3,7 Billionen DM ins Verhältnis gesetzt werden. Der Außenbeitrag beträgt demzufolge ca. 25%. D.h. mit anderen Worten, dass ca. 75% des BSP aus dem Binnenmarkt resultieren. Eine Quote des Außenbeitrags über 30% wäre unrealistisch, da schon jetzt die Aufnahmefähigkeit der Märkte für die Exportprodukte aus der Bundesrepublik begrenzt sind. Denn wie bereits beschrieben, alle Länder versuchen über den Export ihre inneren Probleme zu lösen. Ein permanenter Außenhandelsüberschuss bedeutet bei gleichzeitig relativ geringem Wachstum in den übrigen Industrieländern den Export von Arbeitslosigkeit. Denn dort werden die einheimischen Produkte durch die deutschen Exporte (dort Importgüter) ersetzt. Nachfrageausfall und Beschäftigungsrückgang im Ausland war also ein Ergebnis der starken Handelsposition der Bundesrepublik in der Vergangenheit. Eingeteilt nach Warengruppen exportierte die Bundesrepublik 1998 zu 2/3 hochwertige Industriegüter (Maschinen, Autos chemische und elektrotechnische Erzeugnisse). Den größten Anteil stellten dabei mit ca. 17,8% Büromaschinen/Datenverarbeitung, ca. 17% Straßenfahrzeuge, ca. 13% chemische Erzeugnisse und ca. 10% elektrotechnische Erzeugnisse.
Alles Güter, die auch in den übrigen Industrieländern von einheimischen Unternehmen in denen die Exporte fließen hergestellt werden. Zum Verhältnis von Außenabhängigkeit und Erwerbstätigkeit gibt es u.a. deshalb keine konkreten und eindeutigen Zahlen. Alleine die Ermittlung des Außenbeitrags im Verhältnis zum BSP sagt wenig über die reale Beschäftigungswirkung aus. Erschwert wird eine klare Aussage dadurch, dass es eben keine eindeutige Industrie gibt, die nur für den Export produziert. Denn die Produkte die exportiert werden, sind eben auch Produkte, die auf dem Binnenmarkt abgesetzt werden. Wichtig ist außerdem nicht ein statischer Vergleich, der Ist-Zustand, oder die immer wieder bemühte Aussage jeder vierte deutsche Arbeitsplatz hängt vom Export ab, sondern welche Tendenzen sich aus der Exportorientierung für die Beschäftigungs- und Produktivitätsentwicklung generell ergeben. Also, auf welchem Weg sich die Gesellschaft befindet.
Definiert man die Außenabhängigkeit eines Wirtschaftszweiges als Durchschnitt aus Exportquote und Importquote (jeweils in Prozent des Produktionswertes), dann ergibt sich für den Unternehmensbereich folgende Tendenz (Tabelle 2): Die Zuwächse der Erwerbstätigkeit in Westdeutschland konzentrierten sich in der Vergangenheit auf solche Wirtschaftszweige, die nur gering vom Außenhandel betroffen waren. Dem entspricht, dass die Arbeitsproduktivität desto stärker steigt, je stärker die internationale Konkurrenz ist. In den stark außenabhängigen Wirtschaftsbereichen schrumpft die Erwerbstätigkeit tendenziell. Die Exportwirtschaft kann nicht Träger eines überproportionalen Beschäftigungswachstums sein, so lange die dort erwirtschafteten Überschüsse nicht in massive Kaufkraftsteigerung, Arbeitszeitverkürzung oder Einstellung transformiert werden und damit positive Effekte für den Binnenmarkt hätten.
Tab. 2: Außenabhängigkeit von Unternehmen - Entwicklung von Beschäftigung und Produktivität
|
Wirtschafts- |
Erwerbs- 1980 |
Erwerbs- 1991 |
Erwerbs- 1995 |
Veränderung 1980-1991 % p.A. |
Produktivität 1980-1991 % p.A. |
|
bis 5% in % aller Erwerbstätigen |
8.919 33,1% |
10.594 36,3 |
11.250 39,9% |
+1,6 |
+2,2 |
|
5-20% in % aller Erwerbstätigen |
5.535 20,5% |
5.557 19,0% |
5.313 18,9% |
0 |
+2.0 |
|
20-40% in % aller Erwerbstätigen |
6.403 23,7% |
6.398 21,9% |
5.445 19,3% |
0 |
+3.0 |
|
über 40% in % aller Erwerbstätigen |
1.269 4,7% |
1.010 3,5% |
742 2,6% |
-2,1 |
+3,7 |
|
Alle Unternehmungen in % aller Erwerbstätigen |
22.126 82,0% |
23.559 80,7% |
22.750 80,1% |
0,6 |
+2,7 |
Quelle: von der Vring, Th. (1999:49): Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage – Statistische Analyse der Erwerbstätigkeit in Westdeutschland 1970-1996; Hamburg
Will man etwas über Unternehmensverlagerungen, die Entwicklung von Transnationalen Konzernen (TNK) und/oder die Attraktivität eines Investitionsstandorts aussagen, so muss man sich die Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) ansehen. Als Direktinvestitionsbeziehungen gelten seit Januar 1999 grenzüberschreitende Unternehmensbeteiligungen von 10% und mehr (bisher über 20%) des Kapitals oder der Stimmrechte. Neben dem Beteiligungskapital zählen auch reinvestierte Gewinne und von den Eignern zur Verfügung gestellte Kreditmittel zu den Direktinvestitionen.[20] Die Diskussion über Fusionen, Unternehmenskonzentration und die Möglichkeit der Produktionsverlagerung bzw. Standortdebatte stützt sich hinsichtlich der verwendeten Zahlen einzig auf die Entwicklung der Direktinvestitionen. Anders lassen sich keine allgemein gültigen, relevanten Aussagen über den Internationalisierungsgrad von Produktion und Handel treffen, denn alleine die Aufzählung einzelner Beispiele von Unternehmensverlagerungen führt zu nichts.
Transnationale Konzerne investieren nicht nur in den Aufbau neuer Produktionsstätten, um ausländische Märkte zu erschließen oder günstige Produktionsbedingungen auszunutzen. Vielmehr spielen grenzüberschreitende Fusionen und Aufkäufe sowie Beteiligungen (Joint Ventures) eine immer wichtigere Rolle, seit dem die Wertschöpfungskette der Produktion und Distribution sich ändert. Dabei ist zu unterscheiden zwischen grenzüberschreitenden Investitionen die dem Markteintritt und der Erweiterung (Expansion) dienen und dem Markteintritt, der zur Verdrängung von Konkurrenz vorgenommen wird (Konzentration). In der Realität lassen sich diese Motive nicht voneinander trennen. Gegenwärtig überwiegt jedoch das Motiv der Verdrängung, so dass die gegenwärtige Fusionswelle defensiver Art ist. Defensiv deshalb, da die Kontraktion des Binnenmarktes, fallende Preise, relative Über-kapazitäten, die strukturelle Veränderung aufgrund des technischen Wandels und die steigenden Kosten für Forschung und Entwicklung die Hauptmotive für Fusionen sind. Es geht also darum, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren (in den 70-80er Jahren war Diversifizierung ausschlaggebend) und durch Kostenreduktion (Entlassungen, Lean Management, Outsourcing, Just-in-Time Produktion) den Konkurrenten überlegen zu sein. Das generelle Problem weltweit sinkender Absatzmöglichkeiten in Relation zu den steigenden Produktionskapazitäten wird damit aber nicht gelöst.
Der Anstieg der grenzüberschreitenden Investitionen ist vor allem auf den hohen Anteil an Investitionen für Fusionen und Beteiligungen (Mergers-and-Acquisitions; M&As) zurückzuführen. 1998 betrugen sie 468 Mrd. US$ und bildeten ca. 73% der gesamten weltweiten Investitionsflüsse, die sich auf 644 Mrd. US$ summierten.[21] Primäre Branchen für M&As sind: Banken/Versicherungen, Chemie, Pharmazeutische Industrie und Telekommunikation. Auf die Gruppe der Industrieländer bzw. den dort beheimateten Konzernen entfallen regelmäßig ca. 90% der globalen Fusions- und Beteiligungsinvestitionen. Der höchste Anteil an M&A-Investitionen halten dementsprechend die USA, England, Frankreich und Deutschland. 1999 investierten beispielsweise deutsche Unternehmen 93 Mrd. Euro (ca. 190 Mrd. DM) im Ausland. Alleine die vier größten Firmenzusammenschlüsse, an denen deutsche Investoren beteiligt waren, beliefen sich auf rund 50 Mrd. Euro.[22] Die Konzentration lässt sich zusätzlich daran festmachen, dass die 100 größten Unternehmen gemessen an ihrem ausländischen Kapitalstock über Auslandsaktiva in Höhe von 1,8 Billionen US-Dollar (14% des weltweiten Auslandskapitals[P1]) verfügen.
Die verstärkte regionale (internationale) Vernetzung vollzieht sich besonders über den Dienstleistungssektor. Hier konzentriert sich in den 90er Jahren der höchste Vermögensbestand im Ausland, gefolgt vom Handel (8-25%). Auf den tertiären Sektor entfallen zwischen 55-60% der gesamten jährlichen ADI. Dominiert wird dieser Bereich von Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Der Anstieg der ADI im Dienstleistungsbereich hängt eng mit der Liberalisierung der länderübergreifenden Direktinvestitionstätigkeit für Produktion und Handel zusammen. Da Dienstleistungen in der Regel nicht exportiert werden können und deshalb auch keine Wahlmöglichkeit zwischen Export und Produktion vor Ort (wie bei Industriegütern) besteht, können diese nur dann von ausländischen Unternehmen angeboten werden, wenn das entsprechende Land Investitionen aus dem Ausland gestattet. Gleichzeitig muss zur Erschließung von Märkten der Auf- und Ausbau einer Vertriebs- und Serviecstruktur stattfinden, die entweder den Absatz der Waren (Import/Export der eigenen Produkte) und/oder die eigene Produktion auf diesem „ausländischen“ Markt komplettiert. D.h., die Investitionen sind vor allem handelsbegleitender Art und/oder ergeben Agglomerationsvorteile. Ausschlaggebend für sämtliche ADI ist dabei das Wachstum des Binnenmarktes (Zielland der Investition) bzw. die Absatzmöglichkeiten auf den angestammten Märkten. Die Kontraktion auf dem heimischen Markt verstärkt deshalb immer die Tendenz zur Erschließung neuer Märkte! Was an anderer Stelle als Unterkonsumption bezeichnet wurde und betriebswirtschaftlich als Absatzproblem im Unternehmen auftaucht, soll so grenzüberschreitend gelöst werden. Die Lohnhöhe, respektive die Höhe der Lohnstückkosten, ist dabei nicht das Hauptmotiv für Direktinvestitionen. Zwar spielen Lohnkosten eine gewisse Rolle, wenn international operierende Unternehmen aus dem produzierenden Sektor jenseits der eigenen Grenze investieren. Dieses Investitionsmotiv hat aber eine untergeordnete Bedeutung[CC2] .[23]
Trotz dieser Motive zur Investition im Ausland und der steigenden Bedeutung transnationaler Konzerne sind klare Einschränkungen bezüglich des Internationalisierungsgrades von Unternehmen und ihrer weltweiten Mobilität zu treffen: Nach wie vor ist die „Heimatorientierung und der nationale Standort“ ausschlaggebendes Moment sämtlicher Unternehmensaktivitäten. Dies beinhaltet sowohl die Produktionsstruktur, den Handel mit Waren und Dienstleistungen, der Investitionstätigkeit und den Rückflüssen der Gewinne sowie der getätigten Forschungs- und Entwicklungsausgaben.[24]
In den letzten Dekaden wuchsen die ADI weltweit von ca. 500 Mill. US$ Anfang der 80er Jahre auf ca. 2 Billiarden US$ (insgesamt) in den 90er Jahren. Ein Ende des Wachstums ist trotz jüngster Krisen in den Schwellenländern nicht abzusehen, zumal die Restrukturierung in fast allen Branchen auf Hochtouren läuft. Genau wie der Handel konzentrieren sich die Direktinvestitionen auf die wenigen OECD Staaten und dabei vor allem auf die USA, Europa und Japan. Beispielsweise stieg der Bestand deutscher Direktinvestitionen im Ausland von 1976-90 von 18,4 auf 141,2 Mrd. US$. Diesem Anstieg entspricht die relative Ausweitung des Anteils der Bundesrepublik an den weltweiten ADI in diesem Zeitraum von 7,7% auf 10,1%.[25] Das ist kein Grund zum Wundern, denn Direktinvestitionen folgen immer den Handelsströmen. Marginalisierung im Handel bedeutet also auch wenig Investitionen aus dem Ausland, was die Entwicklungsländer schmerzhaft erfahren müssen und das, obwohl die Personalkosten dort nur minimal sind.
Der komparative Vorteil der geringen Arbeitskosten greift schon lange nicht mehr, um Investitionen anzuziehen, jedenfalls wenn man nach den offiziellen Zahlen geht. Ganz im Gegenteil wird aus den niedrigeren Personalkosten durch die massive Produktivitätsentwicklung in den Industrieländern immer mehr ein komparativer Nachteil für die sogenannten Billiglohnländer. An der These von massiven Unternehmensverlagerung durch die Globalisierung ist dementsprechend mehr ideologisches als reales. Trotzdem kann dies Argument immer wieder für den konkreten Fall genutzt werden, um Zugeständnisse hinsichtlich der Löhne, der Arbeitszeit und der betrieblichen Sozialleistungen von den betroffenen Belegschaften zu erzwingen. Diese Strategie geht auch meistens auf, da die unmittelbare Androhung der Unternehmensverlagerung von den Gewerkschaften, Betriebsräten und der abhängig Beschäftigten nicht wirkungsvoll entgegengetreten werden kann. Sie müssten es in letzter Konsequenz auf eine Unternehmensverlagerung ankommen lassen, was sie aber aufgrund ihrer Abhängigkeitsverhältnisse nicht können.
Abb. 4: Prozentualer Anteil der ausländische Direktinvestitionen nach Regionen
Quelle: World Investment Report 1999
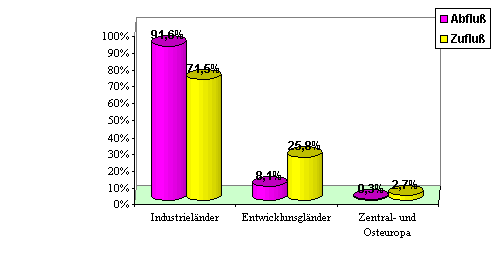 |
Daraus jedoch zu schließen, dass in den USA aufgrund geringerer Kosten produziert wird, um dann die Waren in die Bundesrepublik zu reimportieren ist abwegig. Eine Vielzahl von Faktoren bestimmt die Höhe der Investitionen und die Branchen, in die sie fließen. Für die Bundesrepublik ermittelte bereits 1997 das Ifo-Institut in einer Studie die wichtigsten Gründe, warum eine Investition im Ausland vorgenommen wurde: Hauptargument ist die Erschließung internationaler und nationaler Märkte gefolgt von der Teilnahme am Wachstum dieser Märkte und der Sicherung bereits bestehender Absatzmärkte im Zielland. Zuletzt genannte Gründe sind geringere Lohnkosten und niedrigere Steuern, die jedoch in der wirtschaftspolitischen Diskussion immer als Hauptmotiv bezeichnet werden. Die Struktur der deutschen Direktinvestitionen folgt damit ziemlich genau dem an andere Stelle präsentiertem allgemeinen Muster, denn die Produktion und die Dienstleistung die dort erstellt werden sind vornehmlich in den dortigen Markt integriert.
Die unterstellte Investitionszurückhaltung ausländischer Anleger und Unternehmen in der Bundesrepublik kann auch nicht auf schlechte Bedingungen des Standorts Deutschlands zurückgeführt werden. Zunächst einmal sagt die Quote der Neuinvestitionen in einem Jahr nichts aus. So werden Folgeinvestitionen, re-investierte Gewinne und konzerninterne Kredite nicht immer als Direktinvestitionen definiert. Da aber die Durchdringung des deutschen Marktes mit ausländischen Unternehmen schon eine lange Tradition hat, der Markt also erschlossen ist, wäre dies aussagekräftig, um das tatsächliche Verhalten internationaler Konzerne einschätzen zu können. Viel aussagekräftiger ist der langfristige Bestandsvergleich und die Entwicklung der Investitionen. Dabei zeigen sich keine signifikante Abweichung in den letzten Jahrzehnten. Wenn etwas die Neuinvestitionen behindert, sind es nicht zu hohe Personalkosten oder zu hohe Steuern, sondern das geringe Wachstum des deutschen Marktes, die starken Unternehmen, das Finanzierungssystem der deutschen Unternehmen (bankenzentriert) und die daraus resultierende korporatistische Struktur zwischen Unternehmen, Banken und der Politik.
Generell ergibt sich aus der Faktenlage zur regionalen und sektoralen Verteilung der ADI folgender Zusammenhang: Ist die Binnennachfrage gering, u.a. in Folge einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, bemühen sich die Transnationalen Konzerne ihren Absatz im Ausland zu erhöhen. Durch den Aufbau von Produktionsstätten und Präsenz vor Ort wird versucht, jenseits der eigenen Grenzen die Produktion und damit den Gewinn zu steigern. Es werden dafür Vertriebs- und Servicenetze errichtet, die den Export aus dem Heimatland unterstützen. Da es sich bei den ADI vor allem um Investitionen im Dienstleistungsbereich zur Leistungserbringung vor Ort handelt (Export ist nicht möglich), spielt die Lohnhöhe dafür keine Rolle.
In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden generelle theoretische und empirische Zusammenhänge aufgezeigt, die das Bild von der Globalisierung und den damit verbundenen politischen Veränderungen präzisieren sollten. In diesem Abschnitt geht es vor allem um ökonomische und folglich auch soziale Strukturveränderung. Ob und wie sich diese auch ohne eine stärkere internationale Vernetzung vollziehen, kann hier nicht ausführlich dargestellt werden. Klar geworden sollte sein, dass dies nicht durch die Konkurrenz aus den „Billiglohnländern“ resultiert und auch nicht durch massive Unternehmensverlagerungen erzwungen sind. Der generelle Effekte, der Abnahme Beschäftigung im primären Sektor und im industriellen Sektor zu Gunsten des Aufbaus von Beschäftigung im Dienstleistungssektor ergibt sich mit jeder ökonomischen Entwicklung und hat nichts mit einer Deindustrialisierung zu tun. Vielmehr vollzieht sich der Strukturwandel durch eine veränderte Beziehung zwischen Industrieproduktion und dafür notwendiger Dienstleistungen, dem stärkerem Produktivitätswachstum im industriellen Bereich und den sich daraus ergebenden fallenden Güterpreise. Also, aus primär internen Ursachen resultieren wesentliche Veränderung der Beschäftigungsentwicklung.[28] Demzufolge wird der Abbau von industriellen Arbeitsplätzen nicht unmittelbar auf den Nord-Süd-Handel zurückgeführt. Ausschlaggebender ist der Handel zwischen den Industrieländern, der für eine permanente Produktivitätssteigerung sorgt und bei der gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Ausrichtung das Beschäftigungsproblem verursacht.
Der Anteil des industriellen Sektors am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist u.a. rückläufig, da die Verbraucher, gemessen am Wert, relativ weniger Industriegüter kaufen. Dies lässt sich einerseits mit Sättigungstendenzen in bestimmten Bereichen erklären. Andererseits sind durch die steigende Produktivität die Preise gesunken, so dass der Lohn sowohl zur Befriedigung materieller Bedürfnisse, als auch verstärkt zum Kauf und zur Nutzung von Dienstleistungen eingesetzt werden kann. Machten die Sektoren Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Bildung und Unterhaltung sowie persönliche Ausstattung, die als private Dienstleistungen definiert sind, 1950 noch 16% aller Ausgaben der privaten Haushalte aus, belief sich dies 1991 bereits auf 36,5%.
Tab. 3: Anteil an Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland zu jeweiligen Preisen in Prozent
|
Nahrungs-Genussmittel |
Bekleidung |
Wohnen |
Möbel, Hausrat |
Gesundheit |
Verkehr, Kommunikation |
Freizeit, Bildung |
Persönliche Ausstattung, Sonstiges |
|
|
1900 |
46,7 |
13,0 |
16,2 |
8,3 |
3,0 |
4,1 |
1,4 |
7,4 |
|
1910 |
44,1 |
12,8 |
17,5 |
9,3 |
3,2 |
4,7 |
1,6 |
6,7 |
|
1925 |
43,2 |
13,4 |
12,6 |
12,9 |
3,5 |
5,1 |
3,4 |
5,9 |
|
1935 |
41,7 |
10,7 |
17,0 |
10,1 |
4,8 |
5,7 |
4,4 |
5,7 |
|
1950 |
43,5 |
14,3 |
9,5 |
11,8 |
4,3 |
6,8 |
6,2 |
3,6 |
|
1960 |
37,2 |
11,6 |
12,9 |
11,5 |
4,9 |
9,0 |
8,5 |
4,4 |
|
1970 |
30,0 |
10,3 |
16,3 |
10,1 |
4,6 |
14,0 |
10,2 |
4,4 |
|
1980 |
24,9 |
9,4 |
19,5 |
10,1 |
4,7 |
14,8 |
10,5 |
6,1 |
|
1990 |
22,1 |
8,3 |
20,4 |
9,4 |
5,3 |
17,2 |
10,4 |
7,0 |
|
1997 |
18,9 |
6,8 |
24,6 |
8,6 |
5,9 |
17,5 |
9,9 |
7,8 |
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (1999): Deutschland 2000 – Wandel, Wachstum, Wohlstand; Köln
Die Zunahme der privaten Nachfrage nach konsumnahen Dienstleistungen kann den sektoralen Strukturwandel hin zum Dienstleistungskonsum jedoch nicht erklären. Auch hierfür war der Ausbau des öffentlichen Sektors entscheidend. Nur so konnten sich die konsumnahen Dienstleistungsbranchen überhaupt entwickeln. Zentrale Größe nach 1945 war die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen, die von der öffentlichen Hand ausging. Ausschlaggebend dabei war der Aufbau einer umfassenden sozialen Sicherung und der Ausbau der Infrastruktur. Der Abbau des Sozialstaats und das Spardiktat der Finanzpolitik verringert insgesamt die öffentliche Nachfrage nach Dienstleistungen und verändert so den Umfang und die Qualität des Dienstleistungsangebots. Die mit dem Begriff der Tertiarisierung belegte Strukturänderung ist also vor allem das Resultat der Ausweitung von Dienstleistungen, die von Unternehmen nachgefragt werden. D.h., es sind Vorleistungen der Kreditinstitute und Versicherungen, Dienstleistungen für die materielle Produktion, für den Absatz (Distribution) der Waren und Transportdienstleistungen. Die zunehmende Verwissenschaftlichung der Produktion erhöht dabei die Nachfrage nach Dienstleistungen in den Bereichen Finanzierung, Forschung und Entwicklung, Organisation und Marketing. Ansonsten wäre die moderne industrielle Produktion mit Just-in-time, Lean Production sowie Outsourcing nicht möglich. Dadurch steigt die Produktivität in den traditionellen Sektoren und auch im Dienstleistungssektor permanent. Die immer wieder im Zusammenhang mit der Diskussion um den Niedriglohnsektor geäußerte Meinung, Dienstleistungsarbeitsplätze seien generell durch eine geringere Produktivität gekennzeichnet, stimmt in dieser Einfachheit nicht. Bestimmend ist, welche Art von Dienstleistungen erbracht werden und in welcher Beziehung sie zur Produktion stehen.
Tab.4: Durchschnittliche Entwicklung der Erwerbstätigenproduktivität (Etpr.) und der Arbeitsproduktivität (Apr.) des Produktionspotentials in Prozent für Westdeutschland (1980-91)
|
Branchen |
Ertp. |
Apr. |
|
Land- u. Forstwirtschaft |
+5,2 |
+ 5,7 |
|
Energie/Wasser/Bergbau |
+2,1 |
+2,6 |
|
Verarbeitendes Gewerbe |
+1,3 |
+2,1 |
|
Baugewerbe |
+0,6 |
+0,8 |
|
Handel |
+1,4 |
+2,3 |
|
Verkehr, Nachrichten |
+2,7 |
+3,5 |
|
Finanzdienstleistungen |
+1,8 |
+2,6 |
|
Sonstige Dienstleistungen |
+1,7 |
+2,7 |
|
Alle Unternehmungen |
+1,9 |
+2,7 |
Quelle: von der Vring, a.a.O., S.46
Gleichzeitig erfordert die Exportorientierung und die internationale Arbeitsteilung über den intra-industriellen Handel eine veränderte Produktionsstruktur, wie sie durch die Tertiarisierung der Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird. Denn Transport, Kommunikation, Service und Organisation werden immer wichtiger. Nach tatsächlichen Aufgaben eingeteilt wäre die Beschäftigtenzahl wahrscheinlich für den Dienstleistungssektor höher, als wie sie in den offiziellen Statistik ausgewiesen wird. Nach der amtlichen Statistik 1994 arbeiteten 54% der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) waren es nach der Tätigkeit jedoch bereits 72%, die der Dienstleistung zugerechnet wurden. Nach dem Mikrozensus von 1995 erbrachten sogar 83% der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik im weitesten Sinne Dienstleistungen.
Welche Zahlen nun die Realität am genauesten Abbilden, hängt mit der Meßmethode zusammen. Fakt ist jedoch, dass eine hohe Durchdringung der industriellen Produktion mit Dienstleistungen besteht. Je weiter entwickelt die Ökonomie ist, desto weniger Personen werden für die Produktion benötigt und desto mehr Dienstleistungen können erbracht werden.[29] Dies ist ein wesentlicher Effekt des technischen Fortschritts und damit der Produktivitätsentwicklung. Dabei setzen sich die Prinzipien der industriellen Produktion im Dienstleistungsbereich durch: Standardisierung und Rationalisierung sind ohne weiteres im gesamten Dienstleistungsbereich möglich und werden wohl in Zukunft zu massiven Beschäftigungsabbau führen. Fakt ist auch, dass in fast allen Bereichen der industriellen Dienstleistungen ein hohes Qualifikationsniveau gefordert ist und eine relativ hohe Produktivität angestrebt wird, um die Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten zu garantieren. Eine erste Einteilung der unterschiedlichen Entwicklung, vor allem der relevanten Erwerbstätigenproduktivität, liefert der folgende Vergleich zwischen der BRD und den USA.
Tab. 4) Produktivitätsentwicklung im internationalen Vergleich, durch. jährliche Veränderung 1980-91 in %
|
Produktion |
Erwerbstätige |
Erwerbstätigenproduktivität |
||||
|
BRD-W |
USA |
BRD-W |
USA |
BRD-W |
USA |
|
|
Landwirtschaft |
+2,2 |
+2,9 |
-3,4 |
-1,1 |
+5,8 |
+4,0 |
|
Prod. Gewerbe |
+1,2 |
+2,7 |
-0,4 |
-0,1 |
+1,6 |
+2,8 |
|
Dienstleistung |
+3,2 |
+3,0 |
+1,6 |
+2,8 |
+1,6 |
+0,1 |
|
Gesamt |
+2,3 |
+2,9 |
+0,5 |
+1,8 |
+1,8 |
+1,1 |
Quelle: von der Vring, a.a.O., S.49
Abb. 4) Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen in der BRD, durchschnittliche Veränderung in Prozent
Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft 1999
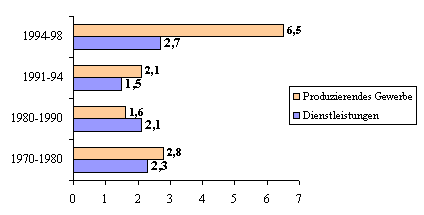 |
Fast alle Dienstleistungsbranchen der Bundesrepublik weisen ein unter dem Durchschnitt der Industriebranchen liegendes Lohnniveau auf. Für den Einzel- und Großhandel lässt sich bis Ende der 80er Jahre ein weiteres Zurückfallen gegenüber dem Industriedurchschnitt feststellen, welches erst Anfang der 90er Jahre durch den Vereinigunsgboom wieder aufgeholt werden konnte. Bei den Kreditinstituten und Versicherungen zeigt sich hingegen laut EUROSTAT (Verdienste, B3) eine Stabilität der Lohndifferenzierung gegenüber den industriellen Sektoren. Vergleicht man dies mit den Zahlen aus Großbritannien, welches als Paradebeispiel eines modernen Arbeitsmarktes gilt, kann man sagen, dass weder das intra-industrielle Differenzierungsniveau noch die trendmäßige Entwicklung in beiden Volkswirtschaften signifikant voneinander abweichen. Insgesamt legen die empirischen Untersuchungen keine Einschränkung der Signalfunktion der Löhne in der Bundesrepublik oder Großbritannien nahe - unabhängig von der Art der Regulierung des Arbeitsmarktes.
Labour-Turnover drückt die Relation von freiwilliger (Kündigung durch den Beschäftigten) und unfreiwilliger Mobilität (Kündigung durch den Arbeitgeber) aus und gilt damit als Maß der Mobilität der abhängig Beschäftigten. Job-Turnover beschreibt die Dynamik des betrieblichen Stellenumbaus, der sich durch Strukturwandel, konjunkturelle Entwicklung und den Lebenszyklus von Unternehmen ergibt. Die Zahl setzt sich zusammen aus der Expansions- und Gründungsrate (Job creation) und der Schließungsrate (Job destruction) von Unternehmen. Job-Turnover beschreibt damit einen Ausschnitt des Labour-Turnover und gibt die notwendige Flexibilität, der Labour-Turnover eine darüberhinausgehende (Überschuss-) Flexibilität an, die auf freiwillige Mobilität, temporäre oder befristetet Einstellungen zurückgeht.
Sowohl in GB als auch in der BRD wechselt etwa jeder 5 Arbeitnehmer in jedem Jahr seinen Arbeitsplatz bzw. geht in die Nicht-Beschäftigung (Arbeitslosigkeit bzw. Nicht-Erwerbstätigkeit) über. Dieser Labour-Turnover ist trendmäßig zwar leicht rückläufig, was aber keine abnehmende Flexibilität des Beschäftigungssystems bedeutet, sondern geht vor allem auf die mit zunehmender Arbeitsmarktschieflage reduzierte freiwillige Arbeitskräftemobilität zurück. Nur etwa 1/3 der gesamten Arbeitskräftemobilität (Labour-Turnover) ist durch eine Stellenrealokation (Job-Turnover) bedingt. Von den verbleibenden 2/3 geht wiederum etwa 1/3 auf freiwillige Mobilität (Bewegung zwischen zwei Beschäftigungen) zurück, 2/3 hingegen betreffen Bewegungen zwischen Beschäftigung und Nicht-Beschäftigung - die als überwiegend unfreiwillig klassifiziert wird.
Angesichts der Zahlen ist schwer einzusehen, worin die immer wieder gegeißelte „Verkrustung“ des deutschen Arbeitsmarktes bestehen soll. Weder zeigen sich auffällige Differenzen zum deutlich weniger regulierten britischen Arbeitsmarkt (nach OECD-Auffassung der Modellarbeitsmarkt), noch zeigen sich „Verbesserungen“ in Großbritannien gegenüber den 70er Jahren, noch lässt der Vergleich mit den USA auf eine gemeinsame Schwäche beider europäischer Arbeitsmärkte schließen.[30]
Die Frage die immer wieder gestellt wird ist: Gibt es überhaupt einen Rückstand bei der Entstehung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich in der Bundesrepublik. Wenn ja, kann dies auf die mangelnde Flexibilität der Löhne, vor allem nach unten, zurückgeführt werden. Nach den vorliegenden Daten ist der „Tertiarisierungsrückstand“ in den 80er Jahren zumindest nicht größer geworden. Wählt man die Summe aller Anteilsveränderungen als Maß des inter-sektoralen Strukturwandels, dann zeigt sich eine Abschwächung in der BRD in den 80er Jahren, während sich die Geschwindigkeit des Strukturwandels in GB scheinbar beschleunigt hat. Zu bedenken ist dabei jedoch, dass die BRD mit einer Exportquote von ca. 30% einen hohen Anteil an industrieller Beschäftigung für hochqualifizierte und spezifizierte Produkte benötigt, während die Exportquote als auch das Exportprofil in GB geringer und auf qualitativ niedrigerem Niveau ist. Großbritannien spielt auf dem Weltmarkt als Exportnation fast keine Rolle mehr. Das die Löhne dementsprechend unterschiedlich hoch ausfallen können, sollte für jeden klar sein, denn höhere Qualifikationen sind in der Regel immer mit höherer Entlohnung verbunden.
Daneben kann aufgrund mangelnden Datenmaterials nichts über den innerbetrieblichen oder auch nur intra-sektoralen Strukturwandel ausgesagt werden. Betrachtet man die Beschäftigungsentwicklung in verschieden Abteilungen des Dienstleistungssektors zeigt sich, dass und zwar besonders ausgeprägt in jenen Dienstleistungen mit hohem Anteil an Geringerqualifizierten die Beschäftigungsentwicklung in der BRD im Dienstleistungssektor besser verlief als in GB. Für den Bereich der industriellen Dienstleistungen zeigt sich dabei gleichzeitig, dass die hohen qualifikationsspezifischen Lohnunterschiede selbst in jenen Branchen, die am meisten von der relativen Absenkung der Entlohnung betroffen waren, keinen erkennbaren positiven Effekt gezeigt haben. Oder anders ausgedrückt, geringere Löhne führten nicht zu mehr Arbeitsplätzen.
In absoluten Zahlen gemessen (BIP pro Kopf) stagniert der Lebensstandard der englischen Bevölkerung seit einigen Jahrzehnten und liegt hinter dem kontinentaleuropäischen Niveau. Daneben gibt es ein kontinuierliches Außenhandelsdefizit in England und eine weitgehende Deindustrialisierung, die auch nicht durch die ständigen Zuflüsse von ausländischen Direktinvestitionen aufgehalten werden konnte. Auch erscheint die immer wieder für den englischen Arbeitsmarkt angeführte positive Beschäftigungsentwicklung eher das Ergebnis zahlreicher Änderungen in der statistischen Erfassung vor und nach Wahlen zu sein. So kommt selbst das englische Finanzministerium zur Einschätzung, dass zwischen 1990-98 real keinerlei Beschäftigungswachstum zu verzeichnen war.
Für 1996 wird sogar festgestellt, dass die englische Produktivität hinter den Entwicklungen in den USA, Frankreich und Deutschland zurückblieb. Gemessen am Produktionsoutput pro Kopf der Beschäftigten lagen Frankreich und Deutschland mit 26% und Amerika mit 29% über dem Output der englischen Arbeitnehmer. Zieht man dabei noch die bereits zuvor dargestellte Diskrepanz der Produktivitätsentwicklung zwischen Deutschland und den USA in Betracht, so verschlechtert sich die Relation zwischen Deutschland und England noch einmal massiv zu Lasten der englischen Ökonomie.[31] Zentrales Problem ist die mangelhafte Investitionstätigkeit, so dass die englischen Beschäftigten eine geringere Kapitalausstattung aufweisen und dementsprechend „unproduktiv“ arbeiten. Die Kapitalintensität in Deutschland ist um 70%, in Frankreich um 50% und in den USA 30% höher als in England. Ein höherer Beschäftigungsgrad resultiert damit aus der geringeren Produktivität und der Möglichkeit bzw. Notwendigkeit, zusätzliche Arbeitskräfte aufgrund geringerer Löhne einzustellen. Britische Unternehmen griffen auf „billige“ Arbeiter zurück, anstatt die Investitionen zu erhöhen und qualifizierte Arbeitskräfte mit höherer Entlohnung einzustellen.
Gleichzeitig bleiben die Ausgaben für Forschung und Entwicklung kontinuierlich hinter allen vergleichbaren deutschen Zahlen zurück. Die immer wieder angeführten hohen Zuflüsse an ausländischem Kapital haben deshalb auch nicht überproportional zu Innovationen oder einer besseren Kapitalausstattung beigetragen, denn sie flossen häufig nicht in den Produktionsbereich. Die Sachkapitalinvestitionen, die trotzdem nach England flossen, wurden genutzt, um vor allem die Importbeschränkungen in die EU zu umgehen, denen z.B. asiatische (vor allem japanische) Exporteure unterlagen. Exemplarisches Beispiel ist Toyota, das etwa 1,4 Mrd. Pfund in England investierte. Der Konzern beschäftigt 3000 Mitarbeiter in zwei Werken (Burnaston und Deeside), wobei 70% der Produktion nach Kontinentaleuropa exportiert wird. Durch den gegenwärtig starken Pfund und den damit verbundenen schlechten Exportaussichten wird die Schließung der Werke erwogen.[32] Ähnliche Diskussionen laufen quer durch alle Branchen in England. Die exportorientierte Einbindung der ausländischen Unternehmen in die englische Wirtschaftsstruktur erweist sich als äußerst fragil, denn die Probleme der mangelnden Nachfrage durch den Rückgang der Exporte kann durch die englischen Konsumenten bzw. Investoren auf dem Binnenmarkt nicht aufgefangen werden.
Markterschließung und -erweiterung vom englischen Standort war das Ziel der Direktinvestitionen. Denn es erschien weniger schwierig, als dies über steigenden Export aus dem außereuropäischen Raum zu versuchen. Daneben ist London der zentrale Finanzplatz, neben der Wall Street, in der Welt. Direktinvestitionen flossen demzufolge in die Bereiche Finanzdienstleistungen und Banken/Versicherungen. Auch hiervon konnte die Industrie kaum profitieren, ganz zu schweigen von den englischen Beschäftigten. Sie müssen mit weniger Lohn und geringeren Sozialleistungen mehr Stunden mit „veralteten“ Produktionsmitteln arbeiten. Auch von „New Labour“ wird diese Situation nicht zum Anlass genommen, mit der fehlgeschlagenen Wirtschaftspolitik der konservativen Regierung zu brechen. Ganz im Gegenteil setzte sich Tony Blair an die Spitze der modernen Sozialdemokratie und fordert die übrigen Regierungen bisher erfolgreich auf, dem englischen Beispiel zu folgen. Die Gemeinsamkeiten zwischen der Entwicklung auf dem englischen und amerikanischen Arbeitsmarkt und den wirtschaftpolitischen Entscheidungen sind vielfältig, so dass sich einige Problembeschreibungen in den folgenden Punkten wiederholen.
Die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt müssen erstens vor dem Hintergrund eines stetigen Bevölkerungswachstums (legale Zuwanderung) von durchschnittlich etwa 2 Mill. Personen pro Jahr interpretiert werden. Zweitens sind in Amerika ca. 6 Mill. illegale Personen (davon 2,5 Mill. Mexikaner) beschäftigt, deren Einkommen überwiegend unter dem gesetzlich festgelegten Minimumeinkommen liegt.[33] Die langfristige Zunahme der Arbeitskräfte ermöglicht nicht nur ein kräftiges Beschäftigungswachstum (in absoluten Zahlen), sondern entschärft auch die Anpassungsprobleme des intersektoralen Strukturwandels der US-Wirtschaft. Konkret bedeutete dies, das billige Arbeitskräfte reichlich vorhanden waren, um das relative Beschäftigungswachstum der US-amerikanischen Wirtschaft zu speisen, welches in den letzten 20 Jahren allein auf das Wachstum im Dienstleistungssektor zurückging, während Industrie- und Agrarbereich anteilig schrumpften.
Weiterer Faktor ist, das das relative Beschäftigungswachstum in den 70er Jahren mit der Zunahme der Teilzeitbeschäftigung und in den 70er und 80er Jahren hauptsächlich mit dem raschen längerfristigen Anstieg der Frauenerwerbsarbeit verbunden war. Der entgegengesetzte Trend zeigt sich bei Männern, insbesondere den gering qualifizierten. Bei ihnen ging die Erwerbsbeteiligung zurück. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze entstanden primär im Dienstleistungssektor mit einer gleichzeitigen Polarisierung zwischen Hochlohn- und Niedriglohntätigkeiten. Dies war verbunden mit einem Rückgang von Arbeitsplätzen, die dem Mittelklasseeinkommen entsprechen. In den 80er Jahren ist das Beschäftigungswachstum eher im Niedriglohnsektor konzentriert gewesen, in den 90er Jahren im Hochlohnsektor. Wobei die Aussage nach den Sektoren, in denen Arbeitsplätze entstehen, nichts über die Einkommenssituation der Beschäftigten und die bestehende Einkommensdifferenzierung in diesen Sektoren aussagt.[34]
Das amerikanische Bureau of Labor Statistics prognostiziert den Arbeitsplatzzuwachs bis zum Jahr 2005 fast ausschließlich in den Dienstleistungsberufen: Dabei dominieren Gesundheitswesen, Erziehung, Gastgewerbe und Einzelhandel. Nur ein Zehntel neuen Jobs wird im viel gepriesen High-Tech Sektor entstehen. Das Gros entsteht also in Berufen mit traditionell niedrigem bis negativem Produktivitätszuwachs und geringen Einkommen. Nur bei 20% der Stellen ist überhaupt mit einer guten Bezahlung zu rechnen. Dabei stehen die prognostizierten Zahlen über den Stellenzuwachs noch nicht einmal im Verhältnis zum Arbeitsplatzabbau in den traditionell höher bezahlten industriellen Branchen. Es kann folglich aufgrund der bisherigen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass hochproduktive Industriearbeitsplätze zugunsten niedrigproduktiver Dienstleistungsjobs verloren gehen.
Neben der Frage, wo die Arbeitsplätze entstanden sind und mit welcher sozialen Absicherung sie verbunden waren, wäre zu klären, ob damit die Arbeitslosigkeit überwunden wird. Dies klingt zwar paradox, aber das „Beschäftigungswunder“ ist nicht mit einem „Arbeitslosigkeitswunder“ zu verwechseln.[35] Denn ein hohes Wachstum der Arbeitsplatzzahl bedeutet nicht den Abbau der Arbeitslosigkeit. Fakt ist, dass gerade der Sektor „Niedriglohnbeschäftigung“ von hoher Arbeitslosigkeit bedroht ist: Kurzfristige Jobs mit geringen Löhnen und geringer Sozialleistung, hohe Entlassungsrate und starker Fluktuation. Gerade in diesem Segment ist die verdeckte Arbeitslosigkeit am höchsten, denn aus der mangelnden sozialen Sicherung in den Jobs resultieren aus ihnen keine bis sehr geringe zukünftige Ansprüche. Bei Arbeitslosigkeit im Niedriglohnbereich lohnt es sich also überhaupt nicht, sich als arbeitslos registrieren zu lassen.
In den 70er Jahren stagnierte das durchschnittliche Reallohnniveau. In den 80er und 90er Jahren bewegten sich die Löhne zwischen den Geschlechtern auseinander. Bei den Männern fiel der Stundenlohn und die Lohnspreizung war mit Reallohnsenkung verbunden, während bei den Frauen der Stundenlohn zunahm und sie Reallohngewinne verbuchen konnte. Die Absenkung der Löhne bei hohem Beschäftigungswachstum und fallenden Arbeitslosenzahlen gelten als Beweis für die Anpassungsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes. Steigende Arbeitslosigkeit und niedrige Erwerbsbeteiligung bei gering qualifizierten Personen, insbesondere bei Afroamerikanern, die neben den Immigranten die geringsten Löhne verdienen, lassen aber darauf schließen, dass die Absenkung der Löhne für diese Gruppen keine ausreichende Beschäftigung ermöglicht.
Ursachen des Reallohnrückgangs bzw. der Lohnspreizung sind: Änderung der „Arbeitsangebotsmenge“, Rückgang der Nachfrage nach wenig qualifizierten Arbeitskräften, ferner der Strukturwandel hin zum Dienstleistungssektor, die Schwächung der Gewerkschaften, die Zunahmen der Importe, im Niedriglohnbereich der Rückgang der Mindestlöhne und die Zunahme der Immigration. Verbunden mit der Lohnspreizung ist ein verschwinden der Mittelschicht. Entsprechend stieg in den 80er Jahren die Armutsrate, insbesondere bei Afroamerikanern. Das viel beschworene Beschäftigungswunder wird damit durch zwei zentrale Faktoren entzaubert. Entgegen der weltweiten Tendenz stieg in den USA zwischen 1980 und 1997 die durchschnittliche Arbeitszeit um 4%. Zum anderen wuchs die Einkommensdiskrepanz und die Konzentration von Reichtum: 1977 entfielen auf die obersten 1% der Haushalte 7,3% des gesamten amerikanischen Volkseinkommens (nach Steuern), bis 1999 stieg dieser Anteil auf 12,9%. Die stärkste Konzentration, seit dem umfassende Daten zur Einkommensentwicklung vorliegen. Damit hielten die obersten 20% der Haushalte 50,4% des gesamten Volkseinkommens, wobei die Mittelschichthaushalte (60% der Haushalte) den geringsten Anstieg aller Zeiten verbuchten. Die Einkommensunterschiede erhöhten sich 1999 so weit, dass das reichste 1% der Bevölkerung so viel Einkommen bezieht, wie die untersten 38% der Bevölkerung. D.h., dass 2,7 Mill. Amerikaner über soviel Einkommen verfügen wie 100 Mill. Bürger auf niedrigem Einkommensniveau.
Abb. 5: Prozentuales Wachstum der Haushaltseinkommen (nach Steuern) von 1977-1999 auf Datenbasis des Congressional Budget Office
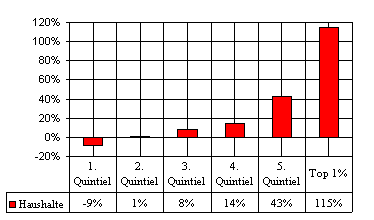 |
Quelle: Shapiro, I./Greenstein, R. (1999): The Widening Income Gulf; in: Center on Budget and Policy Priorities; Washington
Übersetzt auf den industriellen Bereich bedeuten diese allgemeinen Zahlen einen Anstieg der Einkommensunterschiede zwischen einem Fabrikarbeiter und seinem Chef vom 42-fachen (1980) auf das 419-fache im Jahr 1997. Das reale Arbeitseinkommen hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert und liegt bei etwa 33.000 US$ pro Jahr, während das Einkommen der reichsten Amerikaner (1%) im Durchschnitt bei 786.000 US$ vor und 516.000 US$ nach Steuern liegt. Zusätzlich zu den Verteilungswirkungen, die sich direkt aus der Stellung und den Einkommensarten im ökonomischen Prozess ergaben, resultiert die Umverteilung indirekt aus den massiven Änderungen der Steuergesetzgebung. Die Steuerentlastungen für hohe und höchste Einkommen führten dazu, trotz spezieller Mehrbeastungen zwischen 1990-93 im Rahmen der Gesetzgebung zur Haushaltskonsolidierung, dass ihr prozentualer Anteil am gesamten Steueraufkommen unter der Quote von 1977 liegt. Müssten die reichsten 1% der Haushalte genau den gleichen Steueranteil wie damals zahlen, so würden sie pro Kopf im Durchschnitt 40.000 US$ mehr entrichten müssen. Eine Größenordnung, die Angesichts der durchschnittlichen Arbeitseinkommen von 33.000 US$ für sich spricht. Alle Zahlen belegen, dass sich die realen Familieneinkommen auf dem Stand von Mitte der 70er Jahre befinden und stagnieren. Bezogen auf die Beschäftigungssituation bedeutet dies: Es wird länger gearbeitet bei sinkenden Löhnen und bei geringer Produktivität. Um den Lebensstandard zu halten, werden die Spargelder aufgebraucht und, wenn möglich, sich verschuldet.
In der landläufigen Meinung wird die steigende Verschuldung der amerikanischen Privathaushalte im Gegensatz dazu vor allem darauf zurückgeführt, dass das Wirtschaftswachstum und der Börsenboom an der Wall Street dazu führt, dass die Konsumausgaben hoch sind, weil die Amerikaner an dem Wachstum partizipieren (über Löhne und Einkommen aus Aktien) und die Zukunft positiv bewerten. Angesichts der realen Verteilung der Zuflüsse aus Wertpapieren[36] und der Lohnentwicklung kann dies für die Masse der Haushalte nicht stimmen. Denn sie halten keine Wertpapiere in signifikanter Größe und die Löhne stagnieren an breiter Front. Die hohe private Verschuldung geht also nicht auf ein wie auch immer geartetes positives Lebensgefühl zurück, sondern resultiert im Gegenteil aus negativen Faktoren: Bereits zum Halten des „geringen“ Lebensstandards muss die amerikanische Familie die angesparten Reserven aufbrauchen und sich verschulden. Setzt man dazu noch die hohe Armutsrate (ca. 14% leben mit wachsender Tendenz unterhalb der Armutsgrenze) in Beziehung, so ist an der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung, nichts wunderbares zu entdecken. Einziges klares Ergebnis ist, das im Land der „Vollbeschäftigung“ auch ein Arbeitsplatz nicht vor Armut schützt.[37] Willkommen in der „New Economy“ des 21. Jahrhunderts!
Der Abwärtstrend der Reallöhne wird in den USA durch die immer schon geringe soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter begünstigt. Der Sozialstaat nach europäischen Maßstäben existiert nicht. Selbst zaghafte Versuche wenigstens geringe Verbesserung durchzusetzen und eine rudimentäre Sicherung einzuführen, scheiterten in beiden Amtszeiten der Clintonadministration. Dafür stiegen jedoch andere Ausgaben: In Zeiten zunehmender Ungleichverteilung der Einkommen steigen die Kosten der Sicherung des Eigentums. Statt der sozialstaatlichen wurden die klassischen polizeistaatlichen Instrumentarien ausgebaut, aber auch dies nicht ohne Hang zur Privatisierung. Denn neben der Wachstumsbranche Strafvollzug boomen die privaten Wach- und Sicherheitsdienste.[38]
Wie dargestellt weist Deutschland von allen Vergleichsländern, also den Hauptkonkurrenten auf dem Weltmarkt, das mit Abstand schwächste reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auf. Der überdurchschnittliche Rückgang der Lohnstückkosten bei uns durch Rationalisierung, Lohnzurückhaltung und Produktivitätssteigerung hat die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen gestärkt und die Hinwendung zum ausländischen Markt gleichzeitig für viele als überlebensnotwendig erscheinen lassen. Das Wachstum in der bundesdeutschen Industrie, aber auch dem Dienstleistungsbereich, ist verbunden mit hohem Produktivitätszuwachs. Bleibt die Massennachfrage zurück, so führt diese hohe Produktivität dazu, dass die Beschäftigung sinkt. Das setzen auf High-Tech und hohe Qualifikationsanforderungen als Zugang zum Weltmarkt müsste also verbunden werden mit einem qualitativen Wachstum des Binnenmarktes, was aber nicht geschieht. Die Folge ist eine zunehmende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und eine starke Exportorientierung:
Das bedeutet, in den USA ist das Wachstum besonders beschäftigungsintensiv (im Dienstleistungsbereich liegt der Produktivitätszuwachs nahe 0) bei geringem Wachstum des durchschnittlichen Einkommens. Die Einkommenspolarität steigt, es kommt zum „Massenphänomen“ der Laboring-poor (Armut trotz Arbeitsplatz). Ein ähnliches „Beschäftigungswunder“ in der BRD würde u.a. bedeuten, dass die Produktivität in Relation zum Wachstum sinkt, oder das Wachstum im Verhältnis zu den Produktivitätszuwächsen steigt. Beide Ansätze sind bei Beibehaltung der gegenwärtigen Politik problematisch: Variante 1 könnte dazu führen, dass sich von der Transformation der Produktivitätssteigerungen in gesellschaftlichen Fortschritt verabschiedet wird. Variante 2 könnte auf das verkürzte Ziel hinauslaufen, allein ein quantitatives Wachstum zu erzielen und somit ökologischen Notwendigkeiten widersprechen. Dazwischen liegt ein Weg, der nur durch politische Eingriffe durchgesetzt werden kann.
Der Ansatz, die permanente Produktivitätssteigerung zur Erringung von Marktanteilen auf ausländischen Märkten zu nutzen führt dabei in die Sackgasse. Vielmehr ist dies zugunsten einer binnenwirtschaftlichen Orientierung aufzugeben. Verkürzt gesagt wäre die Nachfrage (privat und öffentlich) zu steigern und daneben sind die Produktivitätsfortschritte für einen sozial-ökologischen Umbau einzusetzen. Wir sind damit wieder am Anfang angekommen: Das Problem heißt Unterkonsumption und nicht Globalisierung oder Ende der Arbeitsgesellschaft, wobei die Form, wie die Globalisierung durchgesetzt wird, das Problem der Unterkonsumption verschärft. Gegenwärtig wird hingegen eine vollkommen entgegengesetzte wirtschaftspolitische Zielrichtung favorisiert, die eine Wirkungskette nach sich zieht, wie sie abschließend noch einmal kurz skizziert wird.
[1] John Gray einstiger Chefberater von Margret Thatcher gibt darüber Auskunft. Interessant ist, dass er sich inzwischen zu einem der radikalsten (bürgerlichen) Kritiker seiner einstigen Politik gewandelt hat. Vgl. Gray, J. (1999): Die falsche Verheißung – Der globale Kapitalismus und seine Folgen; Berlin
[2] Butterwege, Ch. (1999:37): Neoliberalismus, Globalisierung und Sozialpolitik – Wohlfahrtsstaat im Standortwettbewerb?; in: Butterwegge u.a.: Herrschaft des Marktes – Abschied vom Staat? – Folgen neoliberaler Modernisierung für Gesellschaft, Recht und Politik; Baden-Baden
[3] O`Rourke, K.H./Williamson, J.G. (1999): Globalization and history – The evolution of a nineteenth-century Atlantic economy; Massachusetts Institute of Technology
[4] vgl. Polyani, K. (1977): The Great Transformation - Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen; Frankfurt a.M.
[5] vgl. International Labour Organization: World Labour Report (97-98) – Industrial Relations, democracy and social stability; und ILO: World Employment Report (98-99) – Employability in the global economy; Genf
[6] vgl. Pohl, G./Schäfer, C. (1996): Niedriglöhne – Die unbekannte Realität: Armut trotz Arbeit; Hamburg
[7] vgl. Zinn, K. G. (1998): Wie Reichtum Armut schafft – Verschwendung, Arbeitslosigkeit und Mangel; Köln
[8] vgl. Krugman, P. (1999): The Return of Depression Economics; London
[9] vgl. Hirsch, J. (1995): Der nationale Wettbewerbsstaat – Staat, Demokratie und Politik im globalen Kapitalismus; Berlin
[10] vgl. Mann, C.L. (1997): Globalization and Productivity in the United States and Germany; in: International Financial Papers No. 595; Board of Governors of the Federal Reserve System; Washington
[11] Schui, H. (1999:752): Was ist Unterkonsumption? Die theoretischen und politischen Bedeutungen eines umstrittenen Begriffs; in: WSI-Mitteilungen 11/1999
[12] DIHT Umfrage, in: SVR-Gutachten 1999/2000 (Schaubild 18)
[13] SVR-Gutachten 1999/2000: Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe (Tab.17)
[14] vgl. Christen, Ch. (1999): Shareholder Value - Zum Zusammenhang von Managementkonzept, Kapitalmarkt und ökonomischer Krise; in: Wirtschaftspolitische Diskussionspapiere Nr.1 (unveröff.)
[15] vgl. Heise, A. (1996): Arbeit für alle – Vision oder Illusion? – Zu den Bestimmungsgründen der Beschäftigungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland während der letzten beiden Dekaden; Marburg
[16] Gauer, Ch./Scriba, J. (1998:40f): Die Standortlüge – Abrechnung mit einem Mythos; Frankfurt a. M.
[17] vgl. Clostermann, J. (1996): Der Einfluss des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz; Diskussionspapiere der Volkswirtschaftlichen Forschungsgruppe 7/96; Deutsche Bundesbank
[18] vgl. Avi-Yonah, R. (2000): Globalization, Tax Competition and the Fiscal Crises of the Welfare State; Working Paper 113; Harvard Law School
[19] Quellen, wenn nicht anders genannt: Statistisches Jahrbuch 1998/1999, Weltentwicklungsbericht 1997/1998
[20] vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank 3/99, S.59
[21] vgl. World Investment Report (WIR) 1998 und 1999 der UNCTAD
[22] vgl. Deutsche Bundesbank Monatsberichte, 3/2000, S. 67
[23] vgl. OECD (1995:21): Recent Trends in Foreign Direct Investment; in: Financial Market Trends, Juni 1995
[24] vgl. Hirst, P./Thompson, G. (1996:76ff): Globalization in Question; Cambridge
[25] vgl. Albert, M./Brock, L./Hessler, St./Menzel, U./Neyer, J. (1999:88): Die neue Weltwirtschaft – Entstofflichung und Entgrenzung der Ökonomie; Frankfurt a.M.
[26] vgl. Doremus, P./Keller, W./Pauly, L./Reich, S. (1999:74ff): The Myth Of The Global Corporation; Princeton
[27] ebenda, S. 116 ff
[28] vgl. Rowthorn, R./Ramaswamy, R. (1999): Growth, Trade, and Deindustrialisation; in: International Monetary Fund Staff Papers, Vol. 46, No.1; Washington DC
[29] vgl. DIW-Wochenbericht 14/2000: Die Industrie in Deutschland in den neunziger Jahren; Berlin
[30] Vgl. Heise, A. (1999:115ff): Grenzen der Deregulierung – Institutioneller und struktureller Wandel in Großbritanien und Deutschland; Düsseldorf
[31] vgl. O`Mahony, M. (1999): Britain`s productivity performance 1950-1996: An international perspective; National Institute for Economic and Social Research; London
[32] vgl. Toyota droht Großbritannien zu verlassen; in: Financial Times Deutschland; 6. April 2000
[33] vgl. Illicit angels of America`s economic miracle; in: Financial Times, 2. Feb. 2000
[34] vgl. Davis, S.J./Haltiwanger, J.C./Schuh, S. (1997): Job Creation and Destruction; MIT Press Cambridge
[35] vgl. Lang, S./Mayer, M./Scherrer, Ch. (1999): Jobwunder USA – Modell für Deutschland?; Münster
[36] vgl. Christen, Ch. (1999); a.a.O.
[37] vgl. Zinn, K.G.: Im Übergang von Spätkapitalismus zum Neofeudalismus? – Die amerikanische Wirtschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts; in: Goldschmidt, W./Klein, D./Steinitz, K. (2000): Neoliberalismus – Hegemonie ohne Perspektive; Heilbronn
[38] vgl. Ganßmann, H./Haas, M. (1999): Arbeitsmärkte im Vergleich - Deutschland, Japan, USA; Marburg
[CC2] genauer Quellennachweis bei Wolf/Mählmann !
| LabourNet Germany: http://www.labournet.de/
Der virtuelle Treffpunkt der Gewerkschafts- und Betriebslinken The virtual meeting place of the left in the unions and in the workplace | ||
| Datei: | ||
| Datum: | ||