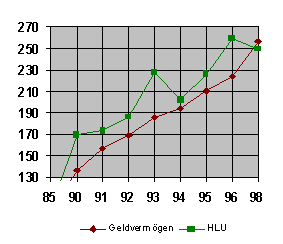
LabourNet Germany | ||||
| Home | Über uns | Suchen | Termine | |
Harald Werner |
| Neidkomplex? |
| Reichtum in einem reichen Land |
| Zahlen deutsche Unternehmen zu hohe Steuern |
| Moderne Wirtschaftspolitik - Ausbeutung wie gehabt |
| Warum müssen wir eigentlich sparen |
Genau darum soll es im Folgenden gehen, denn schlimmer als der soziale Skandal einer zunehmenden Schieflage von Einkommen und Vermögen ist die Rolle des privaten Reichtums, der beschleunigten Umstellung der Ökonomie auf eine bloße Vermögenswirtschaft und die anhaltende staatliche Reichtumspflege.
Der Anlaß für dieses nun dritte Dossier der PDS-Bundestagsfraktion zum Thema Reichtum ist einerseits das Sparpaket der Bundesregierung und andererseits der auch unter der rot-grünen Bundesregierung anhaltende Aberglaube, dass die Bevorzugung der Gewinn- und Vermögenseinkommen durch Steuersenkungen Arbeitsplätze schafft. Es gilt nicht nur nachzuweisen, dass dieses Rezept der Angebotspolitik das Gegenteil bewirkt, sondern, dass diese Politik letztlich verfassungswidrig ist.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schützt zwar das Eigentum, macht aber gleichzeitig in Artikel 14 zur Voraussetzung, dass seine Verwendung dem "Wohle der Allgemeinheit" dient. Davon kann keine Rede mehr sein, seit sich die großen Gewinn und Vermögenseinkommen immer mehr aus der Finanzierung des Gemeinwesens zurückziehen und das private Geldvermögen mit den Aufwendungen für die Sozialhilfe um die Wette wächst.
Wie das Diagramm 1 zeigt, steigen die Ausgaben für Sozialhilfe zum laufenden Lebensunterhalt (HLU) im gleichen Maße wie die Geldvermögen. Auch der leichte Rückgang im vergangenen Jahr und der Knick zwischen 1993 und 1994 signalisieren keine Entspannung der Lage, weil sie nur einen Wechsel in der Gesetzgebung widerspiegeln. Nach 1993 kam es zu einem plötzlichen Absinken durch die Einführung der Pflegeversicherung und die leichte Abnahme im vergangenen Jahr ist eine Folge des Asylbewerberleistungsgesetzes, das die Leistungen für AsylbewerberInnen senkte und gleichzeitig in andere Etats verlagerte.
Ausgehend von der Idee des Sozialstaates, müßte der Verlauf der beiden Kurven genau entgegengesetzt sein: Wachsender gesellschaftlicher Reichtum müßte ein Absinken der Armut zur Folge haben, wenn der Staat seiner durch die Verfassung gesetzten Aufgabe gerecht wird.
Diagramm 1
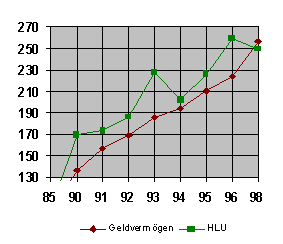
Dass zunehmende soziale Ungerechtigkeit und Spaltung der Gesellschaft gegen die Verfassung verstoßen, ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass die soziale Unausgewogenheit ökonomische Gleichgewichtsstörungen verursacht.
Kapitalistische Krisen sind immer Folgen von Gleichgewichtsstörungen. Die verschiedenen Proportionen der Volkswirtschaft, also etwa das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage oder was nur eine andere Seite davon ist, das Verhältnis zwischen Produktion und Kaufkraft, entwickeln sich nicht störungsfrei, sondern mit großen Schwankungen. In der Regel so, dass sich über einen bestimmten Zeitraum mehr Produktionskapazitäten entwickeln als Kaufkraft vorhanden ist. Phasen des schnellen Aufschwungs, in denen mehr Produktionskapazitäten geschaffen werden, als Nachfrage vorhanden ist, werden von Phasen des Niedergangs gefolgt, in denen es zu Stillegungen, Konkursen und Arbeitslosigkeit kommt. Nach dieser bereinigenden Wirkung der Krise stellt sich ein neuer Aufschwung ein – und so fort
Inzwischen hat sich in den reichen Industrieländern allerdings ein neuer Krisenverlauf herausgebildet, bei dem die reinigende Wirkung der Krise ausbleibt, das überschüssige Kapital nicht mehr vernichtet wird und die Arbeitslosigkeit trotz Aufschwung fortbesteht. Das Ungleichgewicht bleibt, weil zwar Arbeitsplätze aber kaum Kapital vernichtet wird. Einerseits weil es sich dabei überwiegend um Geldkapital handelt, das ein Krisenland sehr schnell verlassen kann und andererseits, weil es eine gewisse Sättigung der Nachfrage gibt.
Der Reichtum entwickelter Volkswirtschaften legt sich nicht mehr in neuen Arbeitsplätzen an, sondern weicht in die Finanzsphäre aus. Eine Möglichkeit, die erst durch die Deregulierung der internationalen Finanzbeziehungen praktikabel wurde. Dieser überschüssige Reichtum bringt einen völlig neuen Krisentyp hervor, nämlich eine Wohlstandskrise, die aber ihr Gegenteil zur Folge hat, nämlich Armut und Elend.
Die Tabelle 1 macht diesen theoretischen Zusammenhang praktisch sichtbar. Sie zeigt, dass Reichtum und Steuererleichterung von abnehmender Beschäftigung, sinkenden Masseneinkommen und wachsender Staatsverschuldung begleitet werden. Die Anhäufung großer privater Vermögen, die sich nicht mehr produktiv anlegen und steuerlich auch nicht abgeschöpft werden sowie Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
Betrachtet man die Entwicklung der Wirtschaft zwischen 1992 und 1998, dann hat die Wirtschaftsleistung, gemessen als Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 22,1 zugenommen. Die Ausgaben des Bundes steigen dagegen nur um 6,5 Prozent, also um fast drei Viertel weniger als die ganze Volkswirtschaft. Dass aber in diesem Zeitraum die Schulden um 46,2 Prozent zulegten, also mehr als doppelt so stark wie die Wirtschaftsleistung, hat einen einfachen Grund: Normalerweise hätten die Steuern aus Gewinn und Vermögen im gleichen Maße zunehmen müssen wie die Leistung der Volkswirtschaft, aber statt dessen nahmen sie um fast den gleichen Prozentsatz ab. Das gleiche gilt für die Arbeitseinkommen. Ihr Zurückbleiben hinter den Profiten führt zwangsläufig, zu stagnierender Nachfrage und Arbeitsplatzabbau.
Es gibt also mindestens zwei Gründe, sich mit der ungleichen Verteilung des Reichtums zu befassen, ohne von Neidgefühlen beherrscht zu sein. Das eine ist das Gebot der Verfassung und das andere ein Gebot ökonomischer Vernunft
In diesem Lande werden von den Statistikämtern Bienenvölker, der Verkauf von Dosenmilch und manch anderes mehr mit einem beachtlichen Aufwand gezählt. Nur mit den Millionären hält sich die Statistik vornehm zurück, ihre wahre Zahl ist ein unerforschtes Geheimnis. Man darf vermuten, daß dies nicht ohne Absicht geschieht. Während die Einkommen der abhängig Beschäftigten bis hin zum durchschnittlichen Stundenlohn der oberfränkischen Putzmacherinnen bis auf den letzten Pfennig statistisch erfaßt sind, fehlt im über 750 Seiten starken Statistischen Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland sogar das Stichwort Millionäre.
Für die diskrete Zurückhaltung gibt es verschiedene Gründe und der entscheidende liegt in der schlichten Tatsache, daß Millionäre in der Regel keine Steuern als Millionäre zahlen. Die Finanzämter erfassen nämlich nicht das vollständige, sondern das der Steuererklärung zugrundeliegende Einkommen und weil es den Millionären versagt ist, sich mit Pflichtbeiträgen an der Sozialversicherung zu beteiligen, mangelt es auch an dieser, für die Einkommen der abhängig Beschäftigten so überaus präzisen Datenbasis. Daß es in der Einkommensstatistik nicht mit rechten Dingen zugeht, verrät auch der Vergleich zwischen den Zahlen der Finanzämter und der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Bei den Finanzämtern werden Jahr für Jahr einige Hundert Milliarden Einkommen weniger angemeldet, als in der Gesamtbilanz der Bundesbank an ausgezahlten Leistungen auftauchen. Schon 1989 brachte eine entsprechende Untersuchung einen Fehlbetrag von 365 Milliarden zu Tage. Was bedeutet, dass jeden Tag eine Milliarde DM an den Finanzämtern vorbeigemogelt wird..
Was der Forschung bleibt sind Umfrageergebnisse, wie die alle drei Jahre stattfindende Erhebung zur Einkommens- und Verbrauchsstatistik (EVS), bei der 45.000 deutsche Haushalte nach Einnahmen und Ausgaben befragt werden. Abgesehen davon, daß die Angaben freiwillig und nach Belieben erfolgen, werden die Bezieher von monatlichen Einnahmen von mehr als 25.000 DM netto erst gar nicht in die Endrechnung einbezogen - aus methodischen Gründen. Diesen Umfragen entziehen sich natürlich die am Fiskus vorbeigeschleusten Vermögen und Vermögenseinkommen in anderen Ländern, so dass die Zahlen über Einkommen und Vermögen der Superreichen in der Statistik stets zu niedrig angesetzt sind. Die Deutsche Steuergewerkschaft DST schätzt die im Ausland geparkten Geldvermögen auf 600 Milliarden Mark.
Da inzwischen auch die Vermögenssteuer abgeschafft ist, fehlt für die Zukunft selbst diese magere Datenbasis. Was bleibt ist also die Einkommensstatistik der Finanzämter. Aber selbst dieser durch die Steuermoral getrübte Blick fällt auf überraschende Zahlen. Nach Informationen der Landesstatistikämter vom September ´96 soll die Zahl der Millionäre in den alten Bundesländern von 1989 bis 1992 um 40 Prozent gestiegen sein und 23.683 betragen haben. Die mindestens 1.000 Millionäre Hamburgs sollen darin noch nicht enthalten sein. Aus der Tabelle 2 ergibt sich dementsprechend auch eine Zahl von mindestens 24.995 Millionären. In den neuen Ländern sollen davon allerdings nur 207 leben. Nach Angaben des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Voscherau sind in der Hansestadt 4.500 Einkommensmillionäre ansässig, von denen die Hälfte überhaupt keine Einkommenssteuer zahlt und dementsprechend in der Statistik fehlt.
Überhaupt muß eine Zahl von rund 25.000 Millionären immer als die unterste Grenze angesehen werden, weil immer mehr Einkommen ins Ausland verlagert werden, obwohl sie in Deutschland entstanden sind. So macht stutzig, daß sich die Zahl der Superreichen, die den Finanzämtern ein jährliches Einkommen von zehn und mehr Millionen im Jahr angaben von 1982 bis 1992 um 144 vermindert hat und deren Gesamteinkünfte um fast die Hälfte niedriger als 1989 ausgefallen sein sollen, obwohl die Zahl der Millionäre insgesamt um 40 Prozent gestiegen ist. Aufschluß über den angeblichen Schwund unter den Superreichen gibt allerdings eine Aufstellung der "Wirtschaftswoche", aus der man erfahren konnte, welche deutschen Milliardäre es inzwischen vorziehen, ihre Einkommen in der Schweiz zu versteuern. "Am Genfer See beispielsweise, im Kanton Waadt", so die Wirtschaftswoche, "leben deutsche Multimillionäre im Dutzend, deren Jahressteuerzahlung in der Größenordnung eines deutschen Facharbeiters liegt. Einzige Einschränkung für solch soziale Steuertarife: Die Steuerpauschalisten dürfen in der Wahlheimat nicht arbeiten." Was sie, wie man weiß, ohnehin anderen überlassen.
Alljährlich listet das Schweizer Wirtschaftsmagazin "Bilanz" rund 50 deutsche Millionäre und Milliardäre auf, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Franken besitzen. Was nicht aufgelistet wird, sind die Milliarden, die diese Elite des deutschen Unternehmertums alljährlich an Waigels Finanztopf vorbeimogelt. Mangelnden Patriotismus kann man ihnen dennoch nicht vorwerfen, denn die Steuerflüchtlinge lassen nicht nur weiterhin in Deutschland arbeiten, sie behalten auch die Deutsche Staatsbürgerschaft, und das aus gutem Grund.
Schweizer zahlen zwar für Kapitalerträge nur eine Einkommensteuer zwischen 18 und 33 Prozent aber Ausländer kommen mit einer Pauschalsteuer davon, die von ihrer Selbsteinstufung abhängt. Daß die Selbsteinstufung weit unter den tatsächlichen Erträgen liegt, ist leicht nachweisbar.So gab der Bremer Kaffeeröster Jacobs der Züricher Finanzverwaltung ein Vermögen von Null an. Was sich jedoch nicht mehr aufrechterhalten ließ, als der Mittellose seine Bremer Rösttrommeln für über drei Milliarden DM an den US Konzern Philip Morris verkaufte.
Eine andere, nicht minder lukrative Fluchtburg ist nach wie vor Liechtenstein, wo es mehr Briefkästenfirmen geben soll, als das kleine Fürstentum Briefkästen aufstellen könnte. Die beliebteste Steuerhinterziehung in Liechtenstein ist die Gründung von Stiftungen, deren Inhaber erstens völlig anonym bleiben, zweitens die geringsten Steuern in Europa zahlen. Und die Liechtensteiner Treuhänder, wie auch das dortige Bankgeheimnis gelten sogar als noch sicherer, wie Schweizer Nummer-Konten.
Es ist allerdings fraglich, ob der Millionär erst bei einem versteuerten Jahreseinkommen von einer Million beginnt oder ob es nicht darum geht, dass jemand real eine Million DM besitzt. Auf diese Weise kommt man nämlich zu gänzlich anderen Zahlen. Nach den Ergebnissen der 1995 zum letzten Mal erhobenen Vermögensteuerstatistik gab es im früheren Bundesgebiet 155.179 Personen oder Haushalte die zur Vermögensteuer mit mindestens einer Million DM Gesamtvermögen herangezogen wurden. Innerhalb von nur zehn Jahren hat sich die Zahl der deutschen Vermögensmillionäre um drei Viertel erhöht. Ihr Gesamtvermögen beziffert die Steuerstatistik auf 563 Milliarden Mark, worauf sie 3,6 Milliarden DM Vermögensteuer bezahlen mußten - das sind bescheidende 0,63 Prozent. Dabei muß man berücksichtigen, daß sich das Vermögen durch diesen Steuersatz keineswegs vermindert, weil sowohl Immobilien, als auch Geld- und Betriebsvermögen jährlich einen im Schnitt mehr als zehnmal so hohen Wertzuwachs erfahren.
Die Vermögensteuer wurde inzwischen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ausgesetzt, was den öffentlichen Haushalten einen Verlust von jährlich mehr als neun Milliarden DM einbringt. Ein großer Teil des sogenannten Sparpakets wäre völlig überflüssig, wenn der Fiskus nach wie vor in den Genuß dieser Steuer käme. Dabei wird in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, als hätten die Karlsruher Richter die Vermögensteuer insgesamt für verfassungswidrig erklärt. Was das Bundesverfassungsgericht jedoch zu seinem Spruch bewog, war nicht die Erhebung einer Steuer auf die großen Vermögen, sondern die ungerechte Bevorzugung der Immobilienvermögen. Denn während Geld- und Betriebsvermögen zu ihrem realen Wert besteuert wurden, gelten für Haus- und Grundbesitzer jahrzehntealte Einheitswerte, die um ein Vielfaches unter dem wahren Wert liegen. Dem könnte leicht abgeholfen werden, wenn Grund und Boden nach ihren tatsächlichen Verkehrswerten besteuert würden.
"Eine Modellrechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt, dass bei einem Freibetrag für Vermögen von 500.000 DM mit einem Vermögensteuersatz von 1 vH der Staat insgesamt 30 Mrd. DM könnte. Um den über viele Jahre eingetretenen massiven Wertzuwächsen beim Hausbesitz durch ArbeitnehmerInnen bzw. SozialeinkommensbezieherInnen Rechnung zu tragen, wird vorgeschlagen, selbstgenutztes Wohneigentum von der Vermögensbesteuerung freizustellen."
Die älteste und ökonomisch unsinnigste Bereicherungsform ist der Gewinn aus sich verteuerndem Boden. Schon der engliche Ökonom Stuart Mills stellte zynisch fest: "Die Grundbesitzer haben das Recht, im Schlaf reich zu werden.". Seit Generationen entstehen aus Bodenbesitzern Millionäre, weil aus einem mageren Acker plötzlich Bauland wird. Seit mindestens 100 Jahren steht deshalb eine Reform der Bodenbesteuerung auf der Tagesordnung. Immer wieder gab es in politischen Umbruchperioden Ansätze, dieses Problem zu lösen, doch bislang ohne dauerhafte Konsequenz.
Das düsterste Kapitel der gescheiterten Anstrengungen dürfte allerdings der deutsche Einigungsprozeß sein, der einen gewaltigen Eigentumstransfer von Ost nach West bewerkstelligte und ungezählte neue Großvermögen schuf. Im Rahmen der Reprivatisierung wurden von 1990 bis 1998 in 30.910 Fällen 427.525 Hektar Boden an Altbesitzer beziehungsweise ihre Erben zurückgegeben.
Aber auch der Freistaat Bayern schrieb noch 1946 in seine Verfassung: "Steigerungen des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen." Eine seit langem diskutierte Möglichkeit wäre die sogenannte Bodenwertsteuer: "Die gesamte Grundstuer wird auf den Boden verlagert, die durch eigene Leistung errichteten Gebäude bleiben steuerfrei...Das Horten von Grundstücken wäre nicht mehr profitabel, die Eigentümer wären zur maximalen baurechtlich zulässigen Nutzung gezwungen."
Die Verteilung der Vermögen ist statistisch außerordentlich schlecht erfaßt, so daß sich in den verschiedenen Untersuchungen recht unterschiedliche Zahlenangaben finden. Hinzu kommt eine mehrfache Veränderung der Erhebungsmethoden, so daß Zahlen aus verschiedenen Erhebungsjahren nur schlecht miteinander verglichen werden können. So wird für 1983 angegeben, dass das obere Zehntel der Haushalte 48,8 Prozent aller Vermögen besaßen, während sie 1988 "nur" noch 44,6 Prozent besessen haben sollen. Der Unterschied ist einfach dadurch bedingt, dass im zweiten Erhebungsjahr das Betriebsvermögen nicht mehr mitgerechnet wurde. Gerade beim Betriebsvermögen ist die Konzentration jedoch besonders hoch. So besaßen bereits 1983 nur 1,8 Prozent aller Haushalte 67,4 Prozent des gesamten Betriebsvermögens. Es bleibt ein Geheimnis politischer Interpretationskunst, warum die linken Modernisierer angesichts einer solchen Machtkonzentration nicht mehr von einer Klassengesellschaft sprechen möchten.
Unabhängig von der mageren Statistik und der Unsicherheit beim Vergleich verschiedener Untersuchungen, stimmen alle Ergebnisse in einer Hinsicht überein. Einkommen und Vermögen sind nicht nur ungleich verteilt, die Ungleichheit nimmt auch ständig zu. Grund ist die explosive Entwicklung der privaten Vermögen im oberen Drittel der Gesellschaft, die von stagnierenden und relativ sogar sinkenden Masseneinkommen begleitet wird. Die Entwicklung der Geldvermögen in den privaten Haushalten (Tabelle 3) ist ebenso beeindruckend, wie die Angabe, dass die Privathaushalte im Schnitt auf ein Gesamtvermögen von 14,5 Billionen DM zurückgreifen können, doch solche Durchschnittszahlen sind ohne großen Aussagewert. Das untere Drittel der deutschen Haushalte hat mehr Schulden als Vermögen, während das obere 70 Prozent aller Vermögenswerte besitzt.
Die primäre Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums durch Erwerbstätigkeit und die Umverteilung durch den Staat, sind nicht die einzigen Mechanismen, die zur sozialen Spaltung führen. Eine häufig verkannte Umverteilung findet durch Erbschaften statt, weil dabei häufig Sach- in Geldvermögen verwandelt werden. Von 1997 bis zum Jahr 2002 werden in der Bundesrepublik nach einer Untersuchung der BBE-Unternehmensberatung zwei Billionen Mark ( 2.000.000.000) vererbt. Die 68er beerben die Wirtschaftswundergeneration und werden dabei reicher sein, als es ihre Eltern je waren, weil es sich bei der Erbmasse überwiegend um Immobilien oder Gewerbevermögen handelt, das von den Erben nicht genutzt, sondern verkauft wird.
Gerade die seit ihrer Bauzeit in den 50er und 60er Jahren enorm im Wert gestiegenen und ehemals eher bescheidenen Einfamilienhäuser, dürften viele Erben in die Gruppe der reichen Haushalte aufsteigen lassen. Was sich die Eltern noch vom Munde absparten, verwandelt sich dank der seit Jahrzehnten florierenden Grundstücksspekulation in profitables Geldvermögen.
Diagramm 2
|
|
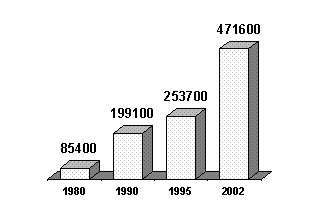 2002 geschätzt 2002 geschätzt |
Gleiches gilt für einen erheblichen Teil der kleineren Betriebsvermögen, die den sogenannten Erblassern zwar den Lebensunterhalt sicherten aber keine hohen Einkommen. Erst mit der Veräußerung wird aus dem unbeweglichen Sachvermögen plötzlich ein höchst flexibles und regelmäßige Rendite abwerfendes Geldkapital. Auch Kammern und Innungen beklagen zunehmend die Unlust der Erben, den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Aber erstens verfügen sie meistens bereits über eine gesicherte Existenz und zweitens bringt der Verkauf des Vermögens eine größere Rendite, als die Weiterführung des elterlichen Geschäfts. Bei Aktienrenditen, die im Deutschland des Jahres 1998 bei rund 30 Prozent lagen, ist die Flucht aus der Real- in die Vermögenswirtschaft außerordentlich verlockend.
Viele Erben von kleinen und mittleren Unternehmen, die in Zeiten des Wirtschaftswunders aufgebaut wurden, haben auf dieser finanziell gesicherten Grundlage ein Studium begonnen und sind heute in gesicherter Stellung. Meistens als erste in der Familie, die eine akademische Laufbahn einschlugen, zeigen sie wenig Neigung, die leitende Position in Staat oder Großunternehmen mit der Leitung eines Handwerksbetriebes oder gar einer Landwirtschaft zu vertauschen.
Der Erbschaftsboom wird das Land aus zwei Gründen noch weiter spalten. Der erste Grund ist die zunehmende Verwandlung früher selbst genutzter Sachvermögen in Geldvermögen. Als Geldkapital vermehrt es sich nicht mehr still, wie die Immobilie oder dient wie das Betriebsvermögen der eigenen Erwerbsarbeit, sondern vermehrt sich aus der Arbeit anderer. Die in die Vermögenswirtschaft eintretende Erbengeneration wird zu einer neuen Schicht von Rentiers, die mit ihrer Anlage das Recht auf Teile des von anderen erarbeiteten Wirtschaftsprodukts erwerben.
Der zweite Grund für die zu erwartende Spaltung liegt im wirtschaftlichen und demographischen Wandel der bundesdeutschen Gesellschaft. Der Erbschaftssegen wird sich nur über bestimmte Gruppen ausgießen, während andere leer ausgehen. Letztere sind Millionen Kinder von eingewanderten Gastarbeitern, die ebenfalls nach Millionen zählenden Aussiedler, die erst seit den 80er Jahren in großen Schüben nach Deutschland kamen und schließlich die Einwohner aus den neuen Ländern, denn der Erbschaftssegen fällt östlich der Elbe deutlich bescheidener aus. Selbst in Sachsen, dem erbenschwersten neuen Bundesland, wird gerade mal etwas mehr als ein Viertel von dem vererbt, was im Westen üblich ist. Übrigens sind die Unterschiede zwischen den Westländern auch nicht kleiner als zwischen neuen und alten Bundesländern. Eine Spitzenstellung nimmt nur Hamburg ein, wo die Erbschaften im Schnitt 20 Prozent über dem westlichen Durchschnitt liegen. Noch gravierender sind die Unterschiede zwischen den Erbschaftsmassen. Fast die Hälfte der Erben kassiert weniger als 100.000 DM, 9,7 Prozent können mit Erbschaften zwischen einer halben und einer ganzen Million und nur 3,8 Prozent werden zu Millionären.
Über einen längeren Zeitraum führt die ungekürzte Vererbung von Vermögen in einer Gesellschaft grundsätzlich zur Verfestigung und Vertiefung sozialer Gegensätze. Gerade unter den Bedingungen der Vermögenswirtschaft, in der sich das "arbeitslose" Einkommen mit weitaus größerer Rendite vermehrt, als die meisten Produktionsvermögen, bildet sich mit der Generation der Erben eine soziale Schicht von Gläubigern, deren Zinserwartungen wie eine Hypothek auf öffentlichen und privaten Haushalten lasten.
Um solche Vermögenskonzentrationen zu vermeiden, wurde die Erbschaftssteuer erdacht. Doch die beginnt erst bei einem Erbe über 100.000 DM und kostet den Erben ersten Grades bis zur halben Million nicht mehr als 7 Prozent. Selbst wer eine Million und mehr erbt, zahlt dafür nicht mehr den Mehrwertsteuersatz. Folglich liegen die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer noch unter der Branntweinsteuer und brachten dem Fiskus 19968 gerade mal vier Milliarden DM.
Ein Ausgleich zwischen dem reicher werdenden Teil der Gesellschaft und den Zurückbleibenden wird damit bei weitem verfehlt. Im Gegenteil, die Erbenwelle wird die soziale Spaltung wie beschrieben vertiefen. Wobei sich die Bundesrepublik noch in einer besonderen Lage befindet, weil ein großer Teil der Bevölkerung das zu vererbende Vermögen hauptsächlich dem Umstand verdankt, in einer einmaligen Schönwetterperiode des deutschen Kapitalismus gelebt zu haben. Die nachfolgenden Generationen sind von dieser Chance ebenso ausgeschlossen, wie die Zugewanderten oder die Zuspätgekommenen neuen Bundesbürger.
Die Senkung der Unternehmenssteuern ist damit jedoch nicht abgeschlossen, denn erst bis zum Ende des Jahres will Bundesfinanzminister Eichel ein vollständiges Konzept vorlegen, mit dem die "große Steuerreform" ihren Abschluß finden soll. Hauptargument für die Unternehmenssteuerreform ist, dass die steuerliche Belastung die Investitionsneigung der Unternehmen behindert und der Schaffung von Arbeitsplätzen im Wege steht. Wie wenig stichhaltig dieses Argument ist, zeigt die Tablle 1, die bereits zwischen 1992 und 1998 einen Rückgang der wichtigsten Unternehmenssteuern um 20,6 Prozent ausweist, obwohl die Wirtschaftstätigkeit in die entgegengesetzte Richtung ging und um 22,1 Prozent zulegte. Wären die Unternehmenssteuern tatsächlich zu hoch, müßten erstens ihre realen Einkommen zurückgehen und zweitens die finanziellen Reserven der Unternehmen schrumpfen. Beides ist nachweislich nicht der Fall.
Wie die Tabelle 4 zeigt, sind die nicht entnommenen Gewinne der Produktionsunternehmen gegenüber 1980 um die märchenhafte Größenordnung von 659 Prozent gestiegen, während die Nettoinvestitionen nur um 54 Prozent höher waren. Und für das vergangenen Jahr stellt die Deutsche Bundesbank fest: "Bei den Unternehmen insgesamt stieg das Aufkommen an nichtentnommenen Gewinnen (einschließlich staatlicher Investitionszuschüsse) binnen Jahresfrist um ein Viertel." Die überaus starke Zunahme der nichtentnommenen Gewinne, bei gleichzeitig äußerst mäßig steigenden Nettoinvestitionen, widerlegt alle Klagen über zu hohe Steuern. Wie später zu zeigen sein wird, gilt das auch für die Löhne. Die Gewinne laufen Steuern und Löhnen davon, ohne dass mehr investiert wird.
Von DaimlerChrysler, dem inzwischen mächtigsten deutschen Konzern ist bekannt, dass er seit drei Jahren in Deutschland keine Ertragssteuern zahlt. Obwohl der Gewinn vor Steuern 1996 stolze 11,1 Milliarden DM betrug, 1997 auf 12 stieg und im vergangenen Jahr fast 16 Milliarden ausmachte, ging der Fiskus leer aus. Andere Konzerne weisen ihre Steuern in den Bilanzen schlicht nicht aus, wobei dies nach Meinung der Süddeutschen Zeitung in den meisten Fällen ein Anzeichen für Steuerfreiheit ist. Das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gilt schon lange nicht mehr, weil überwiegend nur die großen Unternehmen in der Lage sind, die verschiedenen Steuervorteile aiszuschöpfen.
Großkonzerne profitieren insbesondere von der Verrechnung ihrer Erträge mit sogenannten Verlustvorträgen. Sie können zum Beispiel von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die mit Verlust arbeitende Betriebe aufkaufen. Der Kaufpreis ist häufig geringer als der Steuergewinn, so dass es inzwischen einen regelrechten Markt für Pleitefirmen gibt. Die steuerliche Absetzungsmöglichkeit des Verlustvortrages gibt es in dieser Form nur in Deutschland, was zum Beispiel bei der Ehe zwischen Daimler und Chrysler den Ausschlag für die Wahl Stuttgarts als Firmensitz gab. Der neue Weltkonzern kann jetzt getrost rund um den Globus notleidende Automobilwerke aufkaufen und zu Lasten des deutschen Steuerhaushalts sanieren.
Ein Blick auf die Entwicklung der seit Jahren in den Unternehmen gesammelten Geldvermögen (Tabelle 5 und 6) genügt um zu erkennen, weshalb sinkende Unternehmenssteuern zwar Gewinne aber keine Arbeitsplätze schaffen. Sie verwandeln sich in Finanzanlagen, Rücklagen für den globalen Firmenaufkauf und in Vorräte. Die Tabelle 5 veranschaulicht das beschleunigte Wachstum der Geldbestände. Im vergangenen Jahr sind sie auf 5.579,1 Milliarden Mark gestiegen, das entspricht der Wirtschaftsleistung der gesamten deutschen Volkswirtschaft von fast eineinhalb Jahren. Eine weitere Senkung der Unternehmensteuern wird diesen Prozeß fortsetzen.
1998 flossen nur noch 54 Prozent des Ertrages der Produktionsunternehmen in Sachinvestitionen während es 1991 noch 73,8 Prozent waren. Zwar zeigen die Zahlen für 1998 insgesamt eine Verbesserung der Ertrtagslage, weil sämtliche Vermögensarten zugelegt haben, aber das Geldkapital wuchs eindeutig am stärksten. Wobei zu erwähnen ist, dass es sich dabei nicht nur um flüssige Mittel handelt. Der weitaus größte Posten geht auf den Erwerb von Aktien. Gewinnträchtige Unternehmen weiten nicht ihre eigene Produktion aus, sondern beteiligen sich stattdessen an anderen Unternehmen. So schreibt die Deutsche Bundesbank über die gesamtwirtschaftlichen Finanzierungströme im Jahr 1998, dass im Berichtszeitraum etwa ein Viertel der zur Vermögensbildung verwandten Mittel in Aktien flossen. Klassische Produktionsunternehmen verlagern ihre Aktivitäten zunehmend in den Bereich der Vermögenswirtschaft und beteiligen sich insbesondere an ausländischen Unternehmen, um Einfluß auf andere Märkte zu gewinnen. Sie bringen ihren Profit nicht außer Landes, weil hierzulande die Löhne oder die Steuern zu hoch sind, sondern schlüpfen in die Rolle von Banken.
Zusammen mit Handelskrediten, die sie Partnern im Ausland einräumen, haben die deutschen Produktionsunternehmen im vergangenen Jahr 140 Milliarden DM im Ausland investiert, um ihre Machtposition auf den dortigen Märkten auszubauen oder in andere Sektoren einzudringen. Das herausragende Beispiel dafür ist die Fusion von Daimler und Chrysler, bei der der Stuttgarter Automobilriese seine gebunkerten Milliarden für die Eroberung des amerikanischen Marktes einsetzte.
Vor diesem Hintergrund muß auch die Absicht skeptisch betrachtet werden, in Zukunft die im Unternehmen verbleibenden Gewinne höher zu besteuern als die ausgezahlten. Obwohl es gute Gründe gibt, Gewinne, die für Sachinvestitionen verwendet werden, geringer zu besteuern als den Luxuskonsum der Bestverdienenden, zeigen die Tabellen 4 bis 6, wie auch die Angaben der Bundesbank über die Verwendung der Geldbestände in den Produktionsunternehmen, dass dieser Zweck durch die geplante Steuersenkung mit Sicherheit nicht erreicht wird. Die pauschale Begünstigung von nicht entnommenen Gewinnen wird es in erster Linie den großen Kapitalgesellschaften ermöglichen, ihre weltweiten Einkaustouren auszudehnen und genau die Globalisierung zu betreiben unter der sie angeblich zu leiden haben.
Der entscheidende Grund für die inländische Investitionsmüdigkeit der gewinnträchtigen Produktionsunternehmen ist eine weitgehende Sättigung des Binnenmarktes, die durch die rückläufigen Staatsausgaben noch verstärkt wird. Sinkende Unternehmenssteuern, erst recht wenn sie den Staat zur Rücknahme von öffentlichen Investitionsvorhaben zwingen, schaffen keine neuen Arbeitsplätze, sondern bedrohen noch bestehende. Beschäftigungssicherung ist aber auch nur der vorgeschobene und nicht der eigentlich Grund für die Senkung der Unternehmenssteuern.
Hauptsächlich geht es um die Stärkung des deutschen Standortes als Anlagerevier und Geldsammelstelle. Die Kalkulation ist, dass Konzerne wie Chrysler Kapital und Firmensitz nach Deutschland verlagern oder vermehrt Deutsche Aktien gekauft werden, was wiederum die Kriegskassen der deutschen Konzerne füllt. Es geht also in erster Linie um die Macht der großen Konzerne und Deutschlands als finanzkräftigen Standort. Nebenbei sichert das zwar auch den Produktionsstandort, aber es schafft keine neuen Arbeitsplätze, wie die Gleichzeitigkeit wachsender unternehmerischer Geldvermögen und anhaltender Arbeitslosigkeit beweist.
Gegen diesen Argument wird häufig angeführt, dass ohne Steuersenkungen immer mehr Kapital und damit Investititionskraft ausser Landes gehen würde. Ganz davon abgesehen, dass wir sehen konnten, wie wenig steigende Gewinne zu steigenden Investitionen werden, ist Deutschland alles andere als ein Hochsteuerland. Selbst wenn man Steuern und Abgaben, vornehmlich Sozialabgaben, zusammenfaßt, fällt die deutsche Abgabenlast, eher mittelmäßig aus, wie Tabelle 7 veranschaulicht. Die Öffentlichkeit wird in der Regel mit nominalen Steuersätzen konfrontiert, um den Eindruck eines Hochsteuerlandes zu erwecken, doch entscheidender sind die wirklichen Quoten, wie sie sich in der nebenstehenden Tabelle widerspiegeln. Dieser von der OECD errechnete Vergleich deckt sich weitgehend mit einer ähnliche Studie der Weltbank, wo "Deutschland bei der effektiven Steuerbelastung der Kapitalerträge von 14 Industriestaaten erst auf Platz 12 rangiert".
Die Steuerreform der Bundesregierung versucht der großen Diskrepanz zwischen nominalen Steuersätzen und effektiver Steuerzahlung durch die Abschaffung von Ausnahmeregeln und die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage zu verringern. So wurden bereits ein einem ersten Schritt verschiedene nicht mehr zu rechtfertigende Steuervorteile abgeschafft. Weitere Schritte zur Verbesserung der Einnahmen werden in den nächsten Schritten folgen, doch unter dem Strich bleibt immer noch eine Nettoentlastung der Unternehmen von ca. acht Milliarden DM. Wenn die Pläne der Bundesregierung zur Vollendung der Unternehmenssteuerreform abgeschlossen sind, dürfte Deutschland demnächst unter den 14 Industrienationen nicht mehr den Platz 12, sondern den letzten einnehmen.
Die entscheidende volkswirtschaftliche Größe für die Bewertung der sozialen Lage abhängig Beschäftigter ist immer noch der Anteil ihrer Löhne und Gehälter am Volkseinkommen. Erst nach dieser sogenannten Primärverteilung setzt die staatliche Verteilungspolitik ein, um durch soziale Transfers wie Kindergeld, Wohngeld oder Förderung der Vermögensbildung einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Nach dem Schröder/Blair Papier wissen wir, dass dieser umverteilende Staat in der modernen Wirtschaftspolitik keinen Platz mehr hat. Steuerentlastungen, wie sie die Steuerreform der Bundesregierung auch für ArbeitnehmerInnen und dabei besonders für Familien mit sich bringt, beschränken sich auf "Umverteilung in der Klasse". Eine staatliche Umverteilung von den Gewinn- und Vermögenseinkommen, hin zu den sozialen Transfers findet nicht mehr statt. Im Gegenteil, die Sozialausgaben des Bundes werden von noch 48,5 Milliarden DM in 1998, auf 45,7 Milliarden in diesem Jahr und 44,5 Millarden DM in 2000 sinken. Deshalb ist es um so interessanter, wie die allgemeine Tendenz der Primärverteilung in Deutschland aussieht.
Die Tabelle 8 zeigt den Anteil der Bruttoeinkommen von abhängig Beschäftigten am gesamten Volkseinkommen zwischen 1950 und 1998. Dabei spiegelt die "tatsächliche" Lohnquote den nominalen Anteil der Lohnsumme im angegebenen Jahr wider, während die Spalte mit der Überschrift "bereinigt" den wirklichen Anteil wiedergibt, wenn berücksichtigt wird, dass der Anteil der abhängig Beschäftigten an allen laufend Erwerbspersonen zunimmt. Am aussagefähigsten ist die Spalte "Index", aus der sichtbar wird, dass die Verteilungssituation über einen Zeitraum von 48 Jahren mit Ausnahme im Zeitraum zwischen 1975 und 1982 für die abhängig Beschäftigten deutlich schlechter geworden ist. Obwohl die Arbeiter und Angestellten seit 1950 natürlich eine beachtliche Verbesserung ihres Lebensstandards erfuhren, ist ihre Position gegenüber den Beziehern von Gewinn- und Vermögenseinkommen deutlich schlechter geworden. In Westdeutschland hatte sich ihre Position im Jahr 1994 gegenüber den Gründerjahren der Bundesrepublik um 7,1 Prozentpunkte verschlechtert. Noch drastischer fällt die Verschlechterung in der zweiten Hälfte der 90er Jahre aus. Diese für das vereinte Deutschland geltende Zahlenreihe zeigt zwar
Tabelle 5Netto-Geldvermögender Produktionsunternehmen |
||
|
|
Bestand in Mrd. DM |
1980 =100 |
|
1980 |
1.397,9 |
100 |
|
1990 |
2.972,4 |
212,7 |
|
1997 |
4.964,5 |
355,3 |
|
1998 |
5.579,1 |
404,5 |
|
Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Juni 99 |
||
Tabelle 6Jährliche Vermögensbildung der Produktionsunternehmen1991 – 1998 in Mrd. DM |
|||||
|
|
Geldvermögen |
Sachanlagen
|
Vorräte |
Insgesamt |
Sachanlagen v.H. |
|
1991 |
128,0 |
396,4 |
12,8 |
537,2 |
73,8 |
|
1992 |
130,8 |
405,5 |
- 1,7 |
534,6 |
75,9 |
|
1993 |
159,1 |
364,1 |
- 9,2 |
514 |
70,8 |
|
1994 |
111,5 |
371,3 |
16,4 |
499,2 |
74,4 |
|
1995 |
131,2 |
376,7 |
18,3 |
526,2 |
71,6 |
|
1996 |
127,5 |
366,1 |
5,9 |
499,5 |
73,3 |
|
1997 |
92,3 |
380,9 |
47,6 |
520,8 |
73,2 |
|
1998 |
237,4 |
399,6 |
97,3 |
734,3 |
54,4 |
|
Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Juni 1999, S.25 |
|||||
| Tabelle 9
Wertschöpfung pro Arbeitnehmerin 1997 – 1998 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bruttowertschöpfung |
|
|
| Arbeitseinkommen |
|
|
| Mehrwert |
|
|
|
|
|
|
| Beschäftigte |
|
|
|
|
|
|
| Wertschöpfung je Arbeitn. |
|
|
| Eigene Berechnungen nach DIW Wochenbericht 34-35/99 S.636 | ||
am Anfang einen durch den Vereinigungsboom bedingten Anstieg, fällt dann aber in nur vier Jahren um 4,2 Prozentpunkte.
Bedeutsam für diese Verschlechterung sind die Jahre ´97 und ´98, in denen reale Einkommensverluste hingenommen werden mußten. Wie die Tabelle 9 zeigt, haben die ArbeitnehmerInnen 1997 nach Abzug ihres Arbeitsentgelts im Schnitt einen Wert von 40.613 DM geschaffen, ein Jahr später waren es bereits 42.226 DM. Sie haben also vier Prozent mehr geleistet als im Vorjahr, oder anders ausgedrückt: Die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft hat sich in nur einem Jahr um vier Prozent erhöht. Solche Steigerungen werden möglich durch Tarifabschlüsse, die unter der klassischen Lohnformel bleiben, nämlich einer Erhöhung die sich aus der Inflationsrate plus Produktivitätsteigerung zusammensetzt.
Die klassische Lohnformel ist verteilungsneutral. Das heißt, die Verteilung des Volkseinkommens zwischen Arbeitseinkommen auf der einen sowie der Gewinn- und Vermögenseinkommen auf der anderen Seite bleibt gleich. Wie die Tabelle 10 verdeutlicht, konnte dieser Spielraum seit 1993 in keinem der 15 EU-Staaten ausgeschöpft werden. Überall hat die neoliberale Politik, begleitet von einer relativen Schwäche der Gewerkschaften, dazu geführt, dass die Arbeitseinkommen hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurückblieben und die Gewinneinkommen überproportionale stiegen. Wobei die Lohnzurückhaltung der deutschen ArbeitnehmerInnen seit 1996 wesentlich größer ist, als in den anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
Die angeblich moderne Wirtschaftspolitik begründet die Notwendigkeit von Tarifabschlüssen unterhalb der klassischen Lohnformel, mit der Notwendigkeit die Ertragslage der Unternehmen zu verbessern, damit sie neue Arbeitsplätze schaffen. In den vorangegangenen Abschnitten wurde mit zahlreichen Tabellen gezigt, dass es keinen positiven Zusammenhang zwischen wachsenden Gewinnen und Beschäftigung gibt. Die deutlichste Sprache spricht die Tabelle 1 in der ein umgekehrter Zusammenhang deutlich wird. Von 1992 bis 1998 führte weder eine Steigerung der Nettoeinkommen aus Gewinn und Vermögen um 51,7 Prozent noch ein Wachstum der Geldvorräte in den Produktionsunternehmen von fast 100 Prozent zu einer Zunahme der Beschäftigung, sie sank sogar um 6,4 Prozentpunkte ab.
Nun kann nicht behauptet werden, dass ausschließlich steigende Masseneinkommen die Arbeitslosigkeit beseitigen können. Aber eine wirklich moderne Wirtschaftspolitik hätte ausreichend Möglichkeiten, wenn sie eine beschäftigungsfördernde Finanz- beziehungsweise Haushaltspolitik betreiben und darauf verzichten würden, Lohnzurückhaltung zu predigen.
Die Verschuldung des Staates steht in einem scharfen Gegensatz zur Entwicklung des privaten Reichtums und wird nicht etwa durch eine hemmungslose Ausweitung der Ausgaben, sondern durch den Verzicht auf Einnahmen verursacht. Bereits 1988 verkündete das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung stolz: "Seit 1982 werden Investitionen, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in unserem Land nachhaltig gefördert. So wurden vor allem zunächst die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessert, und zwar durch Senkung der Gewerbesteuer, Senkung der betrieblichen Vermögenssteuer, Verkürzung von Abschreibungsfristen, Einführung von Sonderabschreibungen für kleine und mittlere Betriebe. Die Senkung der Einkommensteuersätze 1986 und 1988 kommt selbstverständlich auch den Betrieben zugute...Die Steuersenkungen 1990, vor allem die weitere Senkung des Einkommensteuertarifs und die Senkung der Körperschaftssteuer, werden zusätzliche Impulse für neues wirtschaftliches Wachstum geben." Das WSI hatte bereits vor zwei Jahren festgestellt: "Wäre der Anteil der Gewinnsteuern am gesamten Steueraufkommen heute so groß wie 1980 , hätte der Staat gut 100 Milliarden DM pro Jahr mehr in der Kasse." Mit dem Ergebnis, daß in den staatlichen Haushalten Schulden von über 2,2 Billionen DM aufgelaufen sind und 16,5 Prozent der Steuereinnahmen für Zinsen ausgegeben werden müssen.
Diese sogenannte Angebotspolitik hat ihr Ziel verfehlt, weil sie einerseits die Massenarbeitslosigkeit nicht beseitigen konnte, aber andererseits die Staatsschulden explodieren ließ. Die Ergebnisse dieser Politik spiegeln sich in der Tabelle 1 auf der zweiten Seite wider. Diese Zahlen sind der beste Beweis für den systematischen Irrtum der Angebotspolitik, durch Steuersenkungen die Gewinnsituation der Unternehmen zu verbessern, damit die Investitionstätigkeit zu stimulieren und somit die Zahl der Arbeitsplätze zu erhöhen. Die Steuern auf Gewinn und Vermögen sanken zwar um über 20 Prozent und die Geldvermögen der Unternehmen verdoppelten sich im Verlauf von nur sechs Jahren, aber die Zahl der abhängig Beschäftigten ging um weitere sechs Prozent zurück und die Schulden des Bundes stiegen fast im gleichen Maße wie sich die Nettoeinnahmen aus Gewinn und Vermögen erhöhten.
Die durch die Angebotspolitik betriebene Reichtumspflege erfüllte ihren Zweck nicht, sondern öffnete die Schere zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum noch weiter. Wobei die Bezeichnung privater Reichtum natürlich nicht sämtliche Privathaushalte meint, sondern die Haushalte der Vermögenden, denn die Nettoeinkommen der abhängig Beschäftigten – und das sind fast 90 Prozent aller Erwerbstätigen – wuchsen nur um 4,8 Prozent. Wobei sich auch hier die Frage stellt, wie weit eine Politik noch verfassungskonform ist, die durch einseitige Begünstigung der Gewinn- und Vermögenseinkommen dazu führt, dass die Einkommen der Selbständigen zehnmal so schnell steigen wie die der abhängig Beschäftigten.
Wie vorab bereits in Tabelle 7 gezeigt, ist die Bundesrepublik für Unternehmer alles andere als ein Hochsteuerland und rangiert bei den Abgaben auf Gewinn und Vermögen unter 14 Ländern erst auf dem 12. Platz. Das gilt aber nicht nur für die Unternehmensteuersätzt, sondern für die Staatseinnahmen insgesamt. Wie die folgende Tabelle zeigt, rangieren die aus Einkommen stammenden Staatseinnahmen im internationalen Vergleich ebenfalls im unteren Viertel. Auch die Steuern auf Vermögen und Vermögensverkehr fallen so bescheiden aus, dass die BRD unter 20 Ländern erst den 15. Platz belegt. Steuern auf die Lohnsumme, die es in der Bundesrepublik seit Jahren nicht mehr gibt, werden immerhin noch von sieben Ländern erhoben. Fast einen Spitzenplatz belegt die Bundesrepublik lediglich bei den aus Sozialbeiträgen stammenden Staatseinnahmen. 40,6 Prozent aller Staatseinnahmen stammen aus Sozialbeiträgen, der abhängig Beschäftigten und ihrer Arbeitgeber. Der Satz wird nur noch von Frankreich mit 43,1 Prozent übertroffen, während die Niederlande mit 39,6 Prozent nur knapp hinter der BRD liegen. Es ist allerdings fraglich, ob diese Beiträge überhaupt als Staatseinnahmen bezeichnet werden können, weil sie staatlichem Zugriff entzogen sind und in anderen Ländern Sozialbeiträge von den Arbeitgebern an private Versicherungen gezahlt werden. Diese Beträge tauchen dementsprechend in der Statistik der Staatseinnahmen nicht auf, womit der Eindruck einer geringeren Abgabenlast erweckt wird. In anderen Ländern wie Dänemark werden die sozialen Sicherungssysteme durch Steuern finanziert, so dass unser nördlicher Nachbar nur 3,1 Prozent Staatseinnahmen aus Sozialbeiträgen verbucht. Dafür sind die Einnahmen aus den Einkommensteuern, die die Lohnsteuer einschließen, mit 60,2 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik.
Spielraum für Steuererhöhungen ist also genügend vorhanden, die Frage ist nur, wo sie volkswirtschaftlich sinnvoll sind. Angemessen wäre in jedem Fall eine Abschöpfung in all den Bereichen, wo nicht die Kaufkraft geschmälert oder die Investitionstätigkeit eingeschränkt wird, also bei Vermögenseinkommen und den Spitzenverdienern, die einen erheblichen Teil ihrer Einkommen der Vermögenswirtschaft zuleiten können.
Es bleibt das Geheimnis der rot-grünen Bundesregierung, weshalb sie eine gescheiterte Politik fortsetzt, die über einen Zeitraum von 16 Jahren genau das Gegenteil von dem erreichte, was sie vorgab. Das sogenannte Zukunftsprogramm 2000 stützt sich auf zwei tragende Säulen, einmal auf Einsparungen und zum anderen auf Steuersenkungen. Eigentlich will die Bundesregierung mit ihrem Sparpaket "finanziellen Spielraum schaffen für notwendige Zukunftsinvestitionen", doch die Schwerpunktsetzung bei Einsparungen und Steuersenkungen entspricht den Prioritäten der Vergangenheit. Die größten Einsparungen erfolgen wie gewohnt im Etat des Arbeits- und Sozialministers.
Sie sind damit nicht nur sozial unausgewogen, sondern auch wenig zukunftsfähig. So wird die Absenkung der Sozialbeiträge, die die Bundesanstalt für Arbeit an Kranken und Rentenversicherung bezahlt, die Krankenkassen belasten, die sich durch Beitragserhöhungen schadlos halten werden und die Arbeitslosen werden diese "Einsparung" in wenigen Jahrzehnten mit niedrigeren Renten bezahlen, was dann wiederum zur Erhöhung der dann fälligen Sozialhilfe führen dürfte.
Das Sparpaket wird der Bundesrepublik aber auch noch aus anderen Gründen teuer zu stehen kommen. Ganz im Gegenteil zum hochfliegenden Titel "Zukunftsprogramm" wird gerade auch dort gespart, wo es um die Zukunft geht, nämlich bei Ausbildung und Kultur. Laut Schröder-Blair Papier soll der umverteilende Staat eigentlich durch den sozial investierenden Staat abgelöst werden. Man sollte meinen, dass sich zur Zeit keine soziale Investition mehr lohnt, als in Wissen zu investieren. Wie Tabelle 11 zeigt, tritt das Gegenteil ein.
| Tabelle 12
Sparpaket für Hochschulen, Ausbildung und Kultur im Jahr 2000 in Mio DM |
||
| Hochschulen |
- 80
|
- 3,1%
|
| Ausbildungsförderung, Förderung des wiss. Nachwuchses |
- 408
|
- 20,3%
|
| Berufliche Bildung |
- 53
|
- 2,6%
|
| Kulturelle Angelegenheiten |
- 107
|
- 3,7%
|
Geradezu lächerlich nehmen sich dagegen die Einsparungen aus, die im Finanzbericht 2000 unter der anspruchsvollen Überschrift Subventionsabbau aufgeführt sind. Der darin größte Posten, nämlich die Senkung von Abschreibungssätzen mit einem Volumen von zwei Milliarden Mark, ist wenig größer, als der Verlust den die Arbeitslosen durch die Begrenzung der Lohnersatzleistungen auf die Inflationsrate hinnehmen müssen. Angesichts von 230 Milliarden DM, die Bund, Länder und Gemeinden den Unternehmen noch 1997 durch Steuervergünstigungen oder Finanzhilfen zukommen ließen, mag man bei den aufgeführten Summen des Finanzberichtes kaum noch von Subventionsabbau reden.
Die der Wirtschaft unter der vielversprechenden Überschrift "Subventionsabbau" im Jahr 2000 zugemuteten Kürzungen, belaufen sich auf magere 5,2 Milliarden DM. Gerade mal so viel, wie durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitslosen gespart wird. Angeblich soll der Subventionsabbau die Steuererleichterung der Unternehmen ausgleichen. Doch man darf die Zahlen nicht für die Rechnung halten. Erstens liegt die Steuerentlastung deutlich höher und zweitens handelt es sich bei den im Finanzbericht aufgeführten Subventionskürzungen überwiegend um solche, die den Finanzvorständen der Konzerne nur ein müdes Lächeln entlocken werden. So etwa der Subventionsabbau für die Landwirtschaft, die Kürzungen beim Branntweinmonopol oder gar die 69 Millionen, die dem Sozialen Wohnungsbau entzogen werden.
Sparen bringt weder Wachstum noch Beschäftigung
So sinnvoll eine sparsame Haushaltsführung ist, reich kann man so nicht werden. Reichtum entsteht durch sinnvolle Investitionen. Und das gilt nicht für Unternehmen, sondern auch für den Staat. Der große Haken des rot-grünen Zukunftsprogramms ist deshalb nicht nur seine soziale Schieflage, sondern einerseits der gänzliche Mangel an zukunftsträchtigen Investitionen und andererseits die Reduzierung der Nachfrage.
Öffentliche Investitionen sind eine entscheidende Voraussetzung für die Erhöhung der gesellschaftlichen Produktivität, gleichzeitig aber auch die wichtigsten Lokomotiven der Beschäftigungspolitik. Bereits zwischen 1992 und 1998 ist der Anteil der öffentlichen Investitionen an den Gesamtinvestitionen von 12,7 auf 9,3 Prozent zurückgegangen und während das Bruttoinlandsprodukt um 22,2 Prozent zunahm, wuchsen die öffentlichen Investitionen nur um magere 2,2 Prozent. Daran wird sich nach dem Bundesfinanzbericht zu urteilen nicht nur nichts ändern, die Investitionen werden in wichtigen Bereichen sogar sinken oder mindestens stagnieren.
So wird für den Wohnungs- und Städtebau, der 1999 noch 4,6 Milliarden verbuchen kann, im Jahre 2003 nur noch 2,9 Milliarden ausgegeben, was einem Rückgang um 38.8 Prozent entspricht und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden wird zusammen mit der Unterstützung des Personennahverkehrs für die nächsten vier Jahre auf dem Stand von 1999 eingefroren. Nach Zukunftsprogramm schaut dies alles nicht aus. Weder für die Verbesserung der Infrastruktur, noch für die Beschäftigungssituation.
| Tabelle 13
Eichels schlanker Staat |
|||
| 1998 | 1999 | 2000 | |
|
|
|||
| Veräußerung von Bundesvermörgen | 26,4 | 27,0 | 9,2 |
| Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 26,8 | 18,8 | 14,2 |
| Sachinvestitionen | 13,5 | 14,0 | 12,0 |
| Nach Angaben des DIW: Wochenbericht 34-35/99, S.627 | |||
Dabei gehört es nicht zur Geschichte der Sozialdemokratie, mit staatlichen Investitionen Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln, sondern gerade auch zur Praxis der USA. "Entgegen der hierzulande von konservativen Kräften verkündeten Propaganda ist der starke Anstieg der Beschäftigung nicht primär durch die Förderung eines Niedriglohnsektors und Ungleichverteilung, sondern durch eine expansive Geld- und Finanzpolitik zustande gekommen." Herbert Ehrenberg, sozialkdemokratischer Minister für Arbeit und Sozialordnung unter Helmut Schmidt erinnerte seine Parteifreunde noch im Frühjahr an den Zusammenhang von staatlicher Investitionspolitik und Beschäftigung, als er schrieb: "In den Perioden von 1975 bis 1980 und 1980 bis 1990, in denen die Nettorealeinkommen der Arbeitnehmer und die Zahl der Beschäftigten positive Zuwachsraten aufweisen, stiegen auch die öffentlichen Investitionen um 32,0 bzw. 29,4 Prozent. Von 1980 bis 1985 und von 1992 bis 1997 ging parallel zu den sinkenden Nettoreallöhnen und der rückläufigen Beschäftigung auch das Volumen der öffentlichen Investitionen um 19,3/20,4 Prozent zurück...Öffentliche Investitionen sind darum immer noch der zuverlässigste Hebel, um nachhaltige Beschäftigungseffekte auszulösen, auch wenn uns mit dem Schlagwort der Globalisierung beigebracht werden soll, dass nationale Konjunkturpolitik nicht mehr möglich sei."
Die Auffassung Ehrenbergs wurde der rot-grünen Regierung auch vom DIW ins Pflichtenheft geschrieben, als es 1997 ein Investitionsprogramm von 15 bis 20 Milliarden forderte, um die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Modernisierung des Standortes miteinander zu verbinden. Genutzt haben die Vorschläge wenig. Nach dem Weggang von Oskar Lafontaine und seines Staatssekretärs, dem ehemaligen DIW-Abteilungsleiter Heiner Flassbeck blieb nur der Hang zum Sparen übrig. Diese Sparpolitik wird zudem von weiteren Verkäufen des Bundesvermögens begleitet, die langfristig ebenso zu Lasten künftiger Generationen gehen, wie die Schuldenlast. Wie Tabelle 12 zeigt, belaufen sich die Verkäufe in den letzten drei Haushaltsjahren dieses Jahrzehnts auf 62,6 Milliarden DM und entsprechen damit fast der Hälfte des gesamten Einsparvolumens. Nicht nur, dass der Bund mit dem Verkauf des staatlichen Tafelsilbers politischen Einfluß und Gestaltungsmöglichkeit verliert, er produziert auch neue Einnahmelöcher. Im vergangenen Jahr konnten aus der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Bundes noch 26,8 Milliarden Einnahmen verbucht werden, im kommenden Jahr wird es nur noch gut die Hälfte sein.
Häufig wird der Eindruck erweckt, als müßte die soziale Gerechtigkeit zugunsten konsolidierter Staatsfinanzen zurücktreten. Doch unabhängig davon, dass die Staatsfinanzen nicht nur durch eine bescheidene Ausgabepolitik, sondern auch durch eine gerechte Steuerpolitik saniert werden können, verstößt das Sparmodell der Bundesregierung auch gegen ihren verfassungsmäßigen Auftrag. Im Gegensatz zu allen im Grundgesetz festgehaltenen Haushaltsregeln gehört nämlich die Herstellung sozialer Gerechtigkeit und die Sozialbindung des Eigetums zu den unveränderbaren Grundrechten der Verfassung. Doch wie auf den vorangegangenen Seiten bewiesen wurde, ist die Sozialbindung des Eigentums nur noch eine leere Phrase. Im Artikel 14 des Grundgesetzes heißt es zwar: "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit nutzen." Doch die Angebotspolitik verpflichtet das Kapital zu nichts anderem, als sich zu vermehren. Und vom Dienst zum Wohle der Allgemeinheit wird es durch die Steuerpolitik der Bundesregierung immer mehr befreit.
Wenn die herrschende Politik damit befaßt ist, unveränderliche Bestandteile der Verfassungsordnung in Frage zu stellen, dann lohnt sich ein weiterer Blick ins Grundgesetzt: Artikel 20 Abs. 4: "Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand..."
Seit Jahren wird die prekäre Lage der Staatsfinanzen in öffentlichen Reden auf die sogenannte Erblast aus der deutschen Vereinigung zurückgeführt. Dabei wird erstens regelmäßig ausgeblendet, dass die sogenannte Erblast weniger durch den Nachholbedarf der ehemaligen DDR, als durch die Art des Vereinigungsprozesses entstanden ist und zweitens wird stillschweigend übergangen, dass die Lasten einseitig an den Staatshaushalt und an die Sozialversicherungsträger gingen, während das wirklich rentable Erbe zu Schleuderpreisen in Richtung Westdeutschland privatisiert wurde.
Die beim Bund und den Sozialversicherungsträgern übriggebliebenen Lasten sind in der Tat bedeutend, aber gerade deshalb stellt sich die Frage, wer sie bezahlen soll. Auf die Antwort, dass dies in erster Linie die materiell bevorzugten Gewinner des Einigungsprozesses sein müßten, mußte die Öffentlichkeit bislang vergeblich warten. Auch Heiner Flassbeck kam jüngst in einer Veröffentlichung über "Moderne Finanzpolitik für Deutschland" zu dem Schluß: "Die einfache, aber zugleich wichtigste Frage ist also gerade heute: Wer finanziert die deutsche Einheit?" Denn lange schon sei erkennbar, dass die deutsche Einheit auch durch den Solidaritätszuschlag nicht zu bezahlen sei. Da die Belastungen aus der deutschen Einheit durch laufende Steuereinnahmen nicht mehr zu finanzieren war, verlagerte sie die neokonservative Regierung durch Staatsverschuldung auf die kommenden Generationen.
Flassbeck schreibt: "Der neue Finanzminister will das rasch ändern. Wer bleibt dann, der die Belastungen, die Kosten der deutschen Einheit tragen könnte? Die Antwort ist einfach: Alle diejenigen, die in der einen oder anderen Weise von staatlichen Ausgaben abhängig sind. Angesagt ist dies unter dem positiven Begriff des ´staatlichen Sparens´und des "schlanken Staates". Im Klartext bedeutet es, dass eine Aufgabe, die die Solidarität der gesamten Gesellschaft gefordert hätte, auf kleine und politisch schwache Gruppen wie Arbeitslose und Rentner abgewälzt wird."
Die Alternative wäre ein neuer Verteilungskompromiß, bei dem die Lasten nach der Leistungsfähigkeit und nicht in die Richtung des geringsten Widerstandes verteilt werden. Die Umverteilung von Reichtum und Vermögen, wie auch eine ausgewogenere Beteiligung der Gewinn und Vermögenseinkommen an den Kosten des Gemeinwesen, ist also nicht nur eine Frage sozialer Gerechtigkeit und der ökonomischen Vernunft, sondern auch eine entscheidende Frage der Haushalts- und Finanzpolitik. Das Sparpaket beantwortet auch diese Frage nicht.
| LabourNet Germany: http://www.labournet.de/
Der virtuelle Treffpunkt der Gewerkschafts- und Betriebslinken The virtual meeting place of the left in the unions and in the workplace | ||
| Datei: | ||
| Datum: | ||